Der »neue Irak«
Wahlen, Militäroffensiven und Todesschwadrone –
Herrschaftsstrategien der USA in dem besetzten Land (Teil I)
Von Joachim Guilliard
Ein »dreifaches Hoch auf die Bush-Doktrin« schrieb der Pulitzerpreisträger Charles Krauthammer Anfang März im Time Magazine. Die erfolgreiche Abhaltung der Januar-Wahlen im Irak sei der endgültige Beweis für die Richtigkeit der Entscheidung, in den Irak einzumarschieren. Auch viele Kritiker hätten eingesehen, daß es richtig gewesen sei, militärische Macht zur Durchsetzung demokratischer Ideale einzusetzen und dadurch eine Transformation der arabischen Welt in Gang zu setzen – von endloser Tyrannei und Intoleranz hin zu anständiger Staatsführung und Demokratisierung. Mit den »historisch einmaligen« Wahlen in Afghanistan und Irak, der freien Wahl einer »moderaten« palästinensischen Führung und der »Zedern-Revolution« im Libanon sei die US-Administration mit ihrem »großen Projekt« einer »pan-arabischen Reformation« vorangeschritten, einem »gefährlichen, riskanten und, ja, arroganten aber notwendigen Versuch, die Kultur des Mittleren Osten als solche« zu ändern, um »die Türen zu Demokratie und Moderne zu öffnen.« Die Wahlen im Irak seien möglich geworden, weil die USA nach »dem Schwert«, das das alte Regime stürzte nun den »Schild bereitstellten, der acht Millionen Irakern die erste Ausübung von Selbstregierung« ermöglichte.1
»Geölte« Besatzung
Die Ausführungen des neokonservativen Kolumnisten der Washington Post Krauthammer sind typisch dafür, wie offizielle US-amerikanische Stellen und ihre Verbündeten die im Januar durchgeführten Wahlen zur Rechtfertigung ihrer Politik benutzen.2 Obwohl diese Wahlen ganz offensichtlich demokratischen Standards nicht genügten, wurden sie auch von den Regierungen Deutschlands und anderer eher »kriegskritischer« europäischer Länder anerkannt.
Selbst eine Reihe namhafter Kritiker der US-Politik und erklärter Besat-zungsgegner wie z.B. Noam Chomsky begrüßten – trotz Kritik im Detail – die Wahlen grundsätzlich als Sieg über die Gewalt und als wichtigen Schritt in Richtung Souveränität und Demokratie.
Das ist eine Illusion, wie ein genauerer Blick auf den Charakter der Wahlen und auf den sogenannten »Übergangsprozeß« – d.h. die von den USA konzipierte Reorganisation des irakischen Staates – zeigt. Das Land bleibt weiterhin unter vollständiger Kontrolle der Besatzungsmacht und steht seit der Installation der ersten Interimsregierung ununterbrochen unter Kriegsrecht. Die Wahlen liefern nun den Vorwand, um einen schmutzigen Krieg gegen all die zu intensivieren, die sich den US-Plänen entgegenstellen. Es waren Wahlen, um die »Besatzung zu ölen«, so Salim Lone, ein ehemaliger hoher UN-Mitarbeiter im Irak, nicht, um sie zu beenden.
Der Urnengang zu einem – aus Sicht der USA – so frühen Zeitpunkt war zunächst ein Zugeständnis der Besatzungsmacht an die Besatzungsgegner. Dies ist auch einer der Gründe, weshalb Noam Chomsky die Wahlen positiv wertet. Washington stimmte zu, um zu verhindern, daß angesichts des wachsenden militärischen Widerstandes nicht auch noch die bis dahin passiven Gegner in die offene Rebellion getrieben werden.
Die US-Administration sicherte sich die volle Kontrolle über den gesamten Prozeß. Nicht nur die Wahlen, auch die Grundlagen, auf der die neu gewählten Institutionen arbeiten sollen, wurden von der Besatzungsmacht vorgegeben. In mehr als einhundert Verordnungen, die der einstige Statthalter Paul Bremer vor der Übergabe der formalen Regierungsgewalt an die erste Interimsregierung erlassen hatte, sind die wesentlichen Bereiche in Staat und Wirtschaft bereits fest im Sinne der USA geregelt (siehe hierzu J. Guilliard, »Wahlen als Waffe im Krieg – Ein Überblick über den Wahlprozeß im Irak,
http://www.embargos.de/irak/occupation/hintergrund/wahlen_waffe_jg.htm).
Wochenlanges Postengeschacher
US-Juristen hatten im wesentlichen auch die provisorische Verfassung entworfen. Hier wurde eine Zweidrittelmehrheit für die Wahl der Übergangsregierung und eine Dreiviertelmehrheit für Änderungen an der Verfassung oder Bremers Erlassen festgelegt. Zudem ist stets auch die einstimmige Zustimmung des dreiköpfigen Präsidentenrates nötig. Insgesamt war damit schon sichergestellt, daß das Parlament selbst bei ungünstigem Wahlausgang, den von der Besatzungsmacht vorgegeben Weg nicht verlassen kann.
Das Wahldesign tat sein übriges. Da die Spitzenpositionen aller wichtigen Wahllisten mit Vertretern der verbündeten Organisationen besetzt waren, sitzen nun auch mehrheitlich dieselben Leute in der neuen Regierung, die schon den provisorischen Vorgängerregierungen angehörten. Die meisten von ihnen hatten die Jahrzehnte davor im Ausland verbracht und sind erst mit den Besatzungstruppen in den Irak zurückgekehrt.
Dennoch dauerte der Kampf um Einfluß und Pfründe fast drei Monate, bis sich die Wahlsieger am 28. April endlich auf ein (unvollständiges) neues Kabinett einigen konnten. Neben den Forderungen der kurdischen Parteien nach einem raschen Anschluß der ölreichen Region um Kirkuk an die von ihnen beherrschten Nordprovinzen ging der Streit vor allem um die Kontrolle und die Zusammensetzung der neuen Sicherheitsapparate, die im Laufe des letzten Jahres unter Führung des bisherigen Regierungschefs Iyad Allawi aufgebaut worden waren, unter Einbeziehung einer großen Zahl kollaborationswilliger Angehöriger aus den Sicherheitsdiensten des alten Regimes. Allawi, der engste Verbündete der US-Regierung, forderte für seine Liste daher u. a. das Innenministerium. Die führenden Partien auf der schiitischen Liste, die die Mehrheit der Stimmen erhielt, SCIRI und Dawa, haben allerdings kein Interesse daran, daß sich säkulare, ehemals baathistische Kräfte einen eigenen Machtapparat aufbauen. Sie wollten das Innenressort daher selbst übernehmen und kündigten zunächst auch an, die Ministerien und Sicherheitsdienste von allen zu säubern, die führende Positionen in der Baath-Partei oder im alten Staat innehatten.
Dies zwang die US-Regierung, massiver in die Verhandlungen einzugreifen. US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld flog Anfang April persönlich nach Bagdad und machte klar, daß die irakischen Sicherheitskräfte für die neue Regierung tabu sind. Die einstigen Mitglieder von Saddam Husseins geheimer Polizei seien die »kompetentesten« Kräfte, um den Widerstand zur Strecke zu bringen.
Schließlich einigten sich die US-Verbündeten auf Jalal Talabani, Chef der Patriotischen Union Kurdistans (PUK), als Staatspräsidenten. Seine Stellvertreter wurden Adel Abdel Mahdi vom SCIRI und der bisherige Präsident Ghazi al Yawer, ein reicher und einflußreicher sunnitischer Stammesführer.
Zum neuen Regierungschef wurde Dawa-Chef Ibrahim Jaafari bestimmt, der aus Sicht Washingtons akzeptabelste Kandidat aus der schiitischen UIA-Liste. Jaafari gilt als moderater Schiit und enger Verbündeter der USA. Er steht im Gegensatz zu den SCIRI-Führern auch nicht im Verdacht enger Verbindungen zum Iran. »Er ist unser Junge, nicht der des Iran«, verlautete es aus dem Weißen Haus.
Das neue Kabinett
Das Ausscheiden Allawis ist die einzige Überraschung bei dieser neuen Regierung. Er wird dennoch der wichtigste Mann Washingtons beim Aufbau irakischer Kapazitäten zur Aufstandsbekämpfung bleiben und aufgrund persönlicher Loyalitäten die Kontrolle über die neuen »Sicherheitskräfte« behalten. Für Kontinuität war ohnehin gesorgt. In allen Ministerien bleiben die vom ehemaligen Statthalter Bremer eingesetzten US-amerikanischen »Berater« im Amt und sorgen dafür, daß keines vom rechten Weg abkommt.
Mit dem kurdischen Warlord Jalal Talabani gelangte einer der wendigsten irakischen Politiker an die nominelle Spitze des Staates, mit einer langen Geschichte zwielichtiger Bündnisse mit jedem, der ihm gerade nützlich schien. »Er hat so oft die Seiten gewechselt, daß es sehr ermüdend für mich wäre, jede Wendung aufzuzählen«, charakterisierte ihn Dilip Hiro in einem Interview. In den westlichen Medien wird Talabani gerne als »entschiedener Saddam-Gegner« und als großer Demokrat gefeiert. Auch dieses Bild trügt. Er herrscht als Warlord genauso autokratisch über seinen Teil des Autonomiegebietes wie sein kurdischer Rivale, KDP-Chef Mahssud Barzani. Wie dieser ging er auch mit Saddam Hussein immer wieder Bündnisse ein. Die letzten Bilder, auf denen zu sehen ist, wie Talabani und Hussein einander herzen, stammen vom Juni 1991.3
Die wichtigste Rolle dürfte für Washington aber Talabanis Stellvertreter Adel Abdel Mahdi (SCIRI) zukommen. Der einstige Maoist, der sich zum freien Marktwirtschaftler im radikalislamischen Gewand wandelte, war bisher provisorischer Finanzminister gewesen. Er hatte die von Paul Bremer verordnete Schocktherapie durchgeführt, die die irakische Wirtschaft völlig deregulierte und dem ausländischen Kapital öffnete. Mahdi gilt als der Mann, der die Fortsetzung von Bremers Arbeit garantieren soll.4 Als Vizepräsident kann er im Bedarfsfall jede Änderung an den Verordnungen der Besatzungsbehörde mit seinem Veto blockieren.
Zur Seite wurde ihm Ali Abdel Amir Allawi als Finanzminister gestellt, Chef einer erfolgreichen Londoner Investmentfirma und Berater der Weltbank. Sein Vater war während der Monarchie Gesundheitsminister gewesen. Ali Allawi, der mütterlicherseits ein Neffe Ahmed Chalabis und väterlicherseits ein Cousin von Iyad Allawi ist, hatte den Irak 1956 als Neunjähriger verlassen.
Rückkehr Chalabis
Alarmierend für Iraker ist die Rückkehr des scheinbar unverwüstlichen Ahmed Chalabi. Dem in Jordanien wegen Millionenbetrugs verurteilten Chef des Irakischen Nationalkongresses wurde neben dem Amt des stellvertretenden Ministerpräsidenten zunächst auch kommissarisch das Ölministerium übergeben, bevor es seinem Vertrauten Ibrahim Bahr al-Uloum zugeschlagen wurde. Überall, wo Chalabi und seine Leute mit größeren Geldsummen in Berührung kamen, verschwand ein guter Teil davon auf mysteriöse Weise. Es ist davon auszugehen, daß das gesamte lukrative Ministerium bald von seinen Anhängern durchsetzt sein wird. Obwohl der einstige Pentagonliebling aufgrund seiner zwielichten Machenschaften und mutmaßlichen Verbindungen zum iranischen Geheimdienst in Ungnade gefallen war, wird dennoch vermutet, daß die US-Administration bei der Besetzung des Ölministeriums die Hand im Spiel hatte – Widerstände gegen Privatisierungsmaßnahmen sind von Chalabis Seite nicht zu erwarten.
Auch die Ernennung von Baqir Jabr zum Innenminister verheißt wenig Gutes. Sein eigentlicher Name ist Bayan Sulag – Baqir Jabr ist sein Kriegsname, den er als führendes Mitglied der Badr-Brigaden, dem bewaffneten Arm des SCIRI, erhielt.
Einen Einblick in seine früheren Aktivitäten gibt ein Bericht von Radio Free Europe vom Mai 2000 über einen Raketenangriff auf einen der Regierungspaläste in Bagdad. In einem Interview übernahm Jabr im Namen von SCIRI die Verantwortung für den Anschlag, der mehrere Opfer unter den Angestellten gefordert hatte.
Die Badr-Brigaden wurden im Iran ausgebildet, die meisten der z. T. sehr jungen Milizionäre sind auch dort aufgewachsen und Anhänger der Ideen Ayatollah Khomeinis. Sie führten in den 1990er Jahren eine ganze Reihe von Anschlägen im Irak aus, denen auch eine größere Zahl von Zivilisten zum Opfer fiel. Sie stehen im Verdacht, mit Beginn der Besatzung Todesschwadrone aufgebaut und eine große Zahl ehemaliger Baath-Mitglieder und Funktionäre sowie sonstige politische Gegner ermordet zu haben.
Der SCIRI und die Badr-Brigaden haben sich bisher wie die beiden Kurdenparteien einer Auflösung ihrer Milizen widersetzt. Sie sprechen sich dafür aus, ihre Truppen verstärkt zur Bekämpfung des Widerstands einzusetzen, wodurch der Krieg tatsächlich zunehmend bürgerkriegsähnliche Züge annehmen würde.
PUK und KDP verfügen über je 15 000 Vollzeitkämpfer in quasi regulären Armee-einheiten und weiteren 20 000 bis 25 000 Stammesmilizionäre, insgesamt also über 75 000 Mann.5 Sie stellen damit nach den US-Truppen die mit Abstand größte Streitmacht im Irak. Die Badr-Brigaden werden auf eine Stärke von bis zu 15 000 Mann geschätzt, die ebenfalls gut ausgebildet sind. Auch Dawa und Chalabi sowie weitere US-Verbündete unterhalten eigene Milizen. »Diese Leute bedrohen uns mit einem Warlord-System, daß unser ganzes Land zerstören könnte«, so Wamidh Nadhmi, Sprecher des Irakischen Nationalen Grün-dungskongresses.
Auch die Aufteilung nach ethnisch/konfessionellen Kriterien führt zu heftigen Protesten, auch innerhalb der Nationalversammlung. Hashim Abdul-Rahman al-Shibli, der als »Minister für Menschenrechte« nominiert worden war, um die Zahl der Sunniten im Kabinett zu erhöhen, weigerte sich, auf dieser Basis in die Regierung einzutreten: »die Konzentration auf konfessionelle Identitäten«, führe »zu Spaltungen in Gesellschaft und Staat«.
1 Charles Krauthammer »Three Cheers for the Bush Doctrine –-History has begun to speak, and it says that America made the right decision to invade Iraq«, Time, 7.3.2005.
2 Liberale Kommentatoren stehen ihnen kaum nach. »Bis zu den jüngsten Wahlen im Irak und unter den Palästinensern, war die moderne arabische Welt weitgehend immun gegen die Winde der Demokratie die überall sonst in der Welt geblasen haben« schrieb z.B. auch Thomas L. Friedman in der New York Times v. 7.4.2005 (»Arabs Lift Their Voices«)
3 Dilip Hiro, »Iraq’s New President Jalal Talabani: Ally of CIA, Iranian Intelligence and Saddam Hussein«, Democracy now, 7.4.2005.
4 Pepe Escobar, »What’s behind the new Iraq« und »The shadow Iraqi government« , Asia Times, 8.4.2005 bzw. 21.4.2005
5 Squabble over Iraqi militias, Asia Times, 23.4. 2005.
junge Welt vom 18.5.2005
Herrschaftsstrategien der USA in dem besetzten Land (Teil I)
Von Joachim Guilliard
Ein »dreifaches Hoch auf die Bush-Doktrin« schrieb der Pulitzerpreisträger Charles Krauthammer Anfang März im Time Magazine. Die erfolgreiche Abhaltung der Januar-Wahlen im Irak sei der endgültige Beweis für die Richtigkeit der Entscheidung, in den Irak einzumarschieren. Auch viele Kritiker hätten eingesehen, daß es richtig gewesen sei, militärische Macht zur Durchsetzung demokratischer Ideale einzusetzen und dadurch eine Transformation der arabischen Welt in Gang zu setzen – von endloser Tyrannei und Intoleranz hin zu anständiger Staatsführung und Demokratisierung. Mit den »historisch einmaligen« Wahlen in Afghanistan und Irak, der freien Wahl einer »moderaten« palästinensischen Führung und der »Zedern-Revolution« im Libanon sei die US-Administration mit ihrem »großen Projekt« einer »pan-arabischen Reformation« vorangeschritten, einem »gefährlichen, riskanten und, ja, arroganten aber notwendigen Versuch, die Kultur des Mittleren Osten als solche« zu ändern, um »die Türen zu Demokratie und Moderne zu öffnen.« Die Wahlen im Irak seien möglich geworden, weil die USA nach »dem Schwert«, das das alte Regime stürzte nun den »Schild bereitstellten, der acht Millionen Irakern die erste Ausübung von Selbstregierung« ermöglichte.1
»Geölte« Besatzung
Die Ausführungen des neokonservativen Kolumnisten der Washington Post Krauthammer sind typisch dafür, wie offizielle US-amerikanische Stellen und ihre Verbündeten die im Januar durchgeführten Wahlen zur Rechtfertigung ihrer Politik benutzen.2 Obwohl diese Wahlen ganz offensichtlich demokratischen Standards nicht genügten, wurden sie auch von den Regierungen Deutschlands und anderer eher »kriegskritischer« europäischer Länder anerkannt.
Selbst eine Reihe namhafter Kritiker der US-Politik und erklärter Besat-zungsgegner wie z.B. Noam Chomsky begrüßten – trotz Kritik im Detail – die Wahlen grundsätzlich als Sieg über die Gewalt und als wichtigen Schritt in Richtung Souveränität und Demokratie.
Das ist eine Illusion, wie ein genauerer Blick auf den Charakter der Wahlen und auf den sogenannten »Übergangsprozeß« – d.h. die von den USA konzipierte Reorganisation des irakischen Staates – zeigt. Das Land bleibt weiterhin unter vollständiger Kontrolle der Besatzungsmacht und steht seit der Installation der ersten Interimsregierung ununterbrochen unter Kriegsrecht. Die Wahlen liefern nun den Vorwand, um einen schmutzigen Krieg gegen all die zu intensivieren, die sich den US-Plänen entgegenstellen. Es waren Wahlen, um die »Besatzung zu ölen«, so Salim Lone, ein ehemaliger hoher UN-Mitarbeiter im Irak, nicht, um sie zu beenden.
Der Urnengang zu einem – aus Sicht der USA – so frühen Zeitpunkt war zunächst ein Zugeständnis der Besatzungsmacht an die Besatzungsgegner. Dies ist auch einer der Gründe, weshalb Noam Chomsky die Wahlen positiv wertet. Washington stimmte zu, um zu verhindern, daß angesichts des wachsenden militärischen Widerstandes nicht auch noch die bis dahin passiven Gegner in die offene Rebellion getrieben werden.
Die US-Administration sicherte sich die volle Kontrolle über den gesamten Prozeß. Nicht nur die Wahlen, auch die Grundlagen, auf der die neu gewählten Institutionen arbeiten sollen, wurden von der Besatzungsmacht vorgegeben. In mehr als einhundert Verordnungen, die der einstige Statthalter Paul Bremer vor der Übergabe der formalen Regierungsgewalt an die erste Interimsregierung erlassen hatte, sind die wesentlichen Bereiche in Staat und Wirtschaft bereits fest im Sinne der USA geregelt (siehe hierzu J. Guilliard, »Wahlen als Waffe im Krieg – Ein Überblick über den Wahlprozeß im Irak,
http://www.embargos.de/irak/occupation/hintergrund/wahlen_waffe_jg.htm).
Wochenlanges Postengeschacher
US-Juristen hatten im wesentlichen auch die provisorische Verfassung entworfen. Hier wurde eine Zweidrittelmehrheit für die Wahl der Übergangsregierung und eine Dreiviertelmehrheit für Änderungen an der Verfassung oder Bremers Erlassen festgelegt. Zudem ist stets auch die einstimmige Zustimmung des dreiköpfigen Präsidentenrates nötig. Insgesamt war damit schon sichergestellt, daß das Parlament selbst bei ungünstigem Wahlausgang, den von der Besatzungsmacht vorgegeben Weg nicht verlassen kann.
Das Wahldesign tat sein übriges. Da die Spitzenpositionen aller wichtigen Wahllisten mit Vertretern der verbündeten Organisationen besetzt waren, sitzen nun auch mehrheitlich dieselben Leute in der neuen Regierung, die schon den provisorischen Vorgängerregierungen angehörten. Die meisten von ihnen hatten die Jahrzehnte davor im Ausland verbracht und sind erst mit den Besatzungstruppen in den Irak zurückgekehrt.
Dennoch dauerte der Kampf um Einfluß und Pfründe fast drei Monate, bis sich die Wahlsieger am 28. April endlich auf ein (unvollständiges) neues Kabinett einigen konnten. Neben den Forderungen der kurdischen Parteien nach einem raschen Anschluß der ölreichen Region um Kirkuk an die von ihnen beherrschten Nordprovinzen ging der Streit vor allem um die Kontrolle und die Zusammensetzung der neuen Sicherheitsapparate, die im Laufe des letzten Jahres unter Führung des bisherigen Regierungschefs Iyad Allawi aufgebaut worden waren, unter Einbeziehung einer großen Zahl kollaborationswilliger Angehöriger aus den Sicherheitsdiensten des alten Regimes. Allawi, der engste Verbündete der US-Regierung, forderte für seine Liste daher u. a. das Innenministerium. Die führenden Partien auf der schiitischen Liste, die die Mehrheit der Stimmen erhielt, SCIRI und Dawa, haben allerdings kein Interesse daran, daß sich säkulare, ehemals baathistische Kräfte einen eigenen Machtapparat aufbauen. Sie wollten das Innenressort daher selbst übernehmen und kündigten zunächst auch an, die Ministerien und Sicherheitsdienste von allen zu säubern, die führende Positionen in der Baath-Partei oder im alten Staat innehatten.
Dies zwang die US-Regierung, massiver in die Verhandlungen einzugreifen. US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld flog Anfang April persönlich nach Bagdad und machte klar, daß die irakischen Sicherheitskräfte für die neue Regierung tabu sind. Die einstigen Mitglieder von Saddam Husseins geheimer Polizei seien die »kompetentesten« Kräfte, um den Widerstand zur Strecke zu bringen.
Schließlich einigten sich die US-Verbündeten auf Jalal Talabani, Chef der Patriotischen Union Kurdistans (PUK), als Staatspräsidenten. Seine Stellvertreter wurden Adel Abdel Mahdi vom SCIRI und der bisherige Präsident Ghazi al Yawer, ein reicher und einflußreicher sunnitischer Stammesführer.
Zum neuen Regierungschef wurde Dawa-Chef Ibrahim Jaafari bestimmt, der aus Sicht Washingtons akzeptabelste Kandidat aus der schiitischen UIA-Liste. Jaafari gilt als moderater Schiit und enger Verbündeter der USA. Er steht im Gegensatz zu den SCIRI-Führern auch nicht im Verdacht enger Verbindungen zum Iran. »Er ist unser Junge, nicht der des Iran«, verlautete es aus dem Weißen Haus.
Das neue Kabinett
Das Ausscheiden Allawis ist die einzige Überraschung bei dieser neuen Regierung. Er wird dennoch der wichtigste Mann Washingtons beim Aufbau irakischer Kapazitäten zur Aufstandsbekämpfung bleiben und aufgrund persönlicher Loyalitäten die Kontrolle über die neuen »Sicherheitskräfte« behalten. Für Kontinuität war ohnehin gesorgt. In allen Ministerien bleiben die vom ehemaligen Statthalter Bremer eingesetzten US-amerikanischen »Berater« im Amt und sorgen dafür, daß keines vom rechten Weg abkommt.
Mit dem kurdischen Warlord Jalal Talabani gelangte einer der wendigsten irakischen Politiker an die nominelle Spitze des Staates, mit einer langen Geschichte zwielichtiger Bündnisse mit jedem, der ihm gerade nützlich schien. »Er hat so oft die Seiten gewechselt, daß es sehr ermüdend für mich wäre, jede Wendung aufzuzählen«, charakterisierte ihn Dilip Hiro in einem Interview. In den westlichen Medien wird Talabani gerne als »entschiedener Saddam-Gegner« und als großer Demokrat gefeiert. Auch dieses Bild trügt. Er herrscht als Warlord genauso autokratisch über seinen Teil des Autonomiegebietes wie sein kurdischer Rivale, KDP-Chef Mahssud Barzani. Wie dieser ging er auch mit Saddam Hussein immer wieder Bündnisse ein. Die letzten Bilder, auf denen zu sehen ist, wie Talabani und Hussein einander herzen, stammen vom Juni 1991.3
Die wichtigste Rolle dürfte für Washington aber Talabanis Stellvertreter Adel Abdel Mahdi (SCIRI) zukommen. Der einstige Maoist, der sich zum freien Marktwirtschaftler im radikalislamischen Gewand wandelte, war bisher provisorischer Finanzminister gewesen. Er hatte die von Paul Bremer verordnete Schocktherapie durchgeführt, die die irakische Wirtschaft völlig deregulierte und dem ausländischen Kapital öffnete. Mahdi gilt als der Mann, der die Fortsetzung von Bremers Arbeit garantieren soll.4 Als Vizepräsident kann er im Bedarfsfall jede Änderung an den Verordnungen der Besatzungsbehörde mit seinem Veto blockieren.
Zur Seite wurde ihm Ali Abdel Amir Allawi als Finanzminister gestellt, Chef einer erfolgreichen Londoner Investmentfirma und Berater der Weltbank. Sein Vater war während der Monarchie Gesundheitsminister gewesen. Ali Allawi, der mütterlicherseits ein Neffe Ahmed Chalabis und väterlicherseits ein Cousin von Iyad Allawi ist, hatte den Irak 1956 als Neunjähriger verlassen.
Rückkehr Chalabis
Alarmierend für Iraker ist die Rückkehr des scheinbar unverwüstlichen Ahmed Chalabi. Dem in Jordanien wegen Millionenbetrugs verurteilten Chef des Irakischen Nationalkongresses wurde neben dem Amt des stellvertretenden Ministerpräsidenten zunächst auch kommissarisch das Ölministerium übergeben, bevor es seinem Vertrauten Ibrahim Bahr al-Uloum zugeschlagen wurde. Überall, wo Chalabi und seine Leute mit größeren Geldsummen in Berührung kamen, verschwand ein guter Teil davon auf mysteriöse Weise. Es ist davon auszugehen, daß das gesamte lukrative Ministerium bald von seinen Anhängern durchsetzt sein wird. Obwohl der einstige Pentagonliebling aufgrund seiner zwielichten Machenschaften und mutmaßlichen Verbindungen zum iranischen Geheimdienst in Ungnade gefallen war, wird dennoch vermutet, daß die US-Administration bei der Besetzung des Ölministeriums die Hand im Spiel hatte – Widerstände gegen Privatisierungsmaßnahmen sind von Chalabis Seite nicht zu erwarten.
Auch die Ernennung von Baqir Jabr zum Innenminister verheißt wenig Gutes. Sein eigentlicher Name ist Bayan Sulag – Baqir Jabr ist sein Kriegsname, den er als führendes Mitglied der Badr-Brigaden, dem bewaffneten Arm des SCIRI, erhielt.
Einen Einblick in seine früheren Aktivitäten gibt ein Bericht von Radio Free Europe vom Mai 2000 über einen Raketenangriff auf einen der Regierungspaläste in Bagdad. In einem Interview übernahm Jabr im Namen von SCIRI die Verantwortung für den Anschlag, der mehrere Opfer unter den Angestellten gefordert hatte.
Die Badr-Brigaden wurden im Iran ausgebildet, die meisten der z. T. sehr jungen Milizionäre sind auch dort aufgewachsen und Anhänger der Ideen Ayatollah Khomeinis. Sie führten in den 1990er Jahren eine ganze Reihe von Anschlägen im Irak aus, denen auch eine größere Zahl von Zivilisten zum Opfer fiel. Sie stehen im Verdacht, mit Beginn der Besatzung Todesschwadrone aufgebaut und eine große Zahl ehemaliger Baath-Mitglieder und Funktionäre sowie sonstige politische Gegner ermordet zu haben.
Der SCIRI und die Badr-Brigaden haben sich bisher wie die beiden Kurdenparteien einer Auflösung ihrer Milizen widersetzt. Sie sprechen sich dafür aus, ihre Truppen verstärkt zur Bekämpfung des Widerstands einzusetzen, wodurch der Krieg tatsächlich zunehmend bürgerkriegsähnliche Züge annehmen würde.
PUK und KDP verfügen über je 15 000 Vollzeitkämpfer in quasi regulären Armee-einheiten und weiteren 20 000 bis 25 000 Stammesmilizionäre, insgesamt also über 75 000 Mann.5 Sie stellen damit nach den US-Truppen die mit Abstand größte Streitmacht im Irak. Die Badr-Brigaden werden auf eine Stärke von bis zu 15 000 Mann geschätzt, die ebenfalls gut ausgebildet sind. Auch Dawa und Chalabi sowie weitere US-Verbündete unterhalten eigene Milizen. »Diese Leute bedrohen uns mit einem Warlord-System, daß unser ganzes Land zerstören könnte«, so Wamidh Nadhmi, Sprecher des Irakischen Nationalen Grün-dungskongresses.
Auch die Aufteilung nach ethnisch/konfessionellen Kriterien führt zu heftigen Protesten, auch innerhalb der Nationalversammlung. Hashim Abdul-Rahman al-Shibli, der als »Minister für Menschenrechte« nominiert worden war, um die Zahl der Sunniten im Kabinett zu erhöhen, weigerte sich, auf dieser Basis in die Regierung einzutreten: »die Konzentration auf konfessionelle Identitäten«, führe »zu Spaltungen in Gesellschaft und Staat«.
1 Charles Krauthammer »Three Cheers for the Bush Doctrine –-History has begun to speak, and it says that America made the right decision to invade Iraq«, Time, 7.3.2005.
2 Liberale Kommentatoren stehen ihnen kaum nach. »Bis zu den jüngsten Wahlen im Irak und unter den Palästinensern, war die moderne arabische Welt weitgehend immun gegen die Winde der Demokratie die überall sonst in der Welt geblasen haben« schrieb z.B. auch Thomas L. Friedman in der New York Times v. 7.4.2005 (»Arabs Lift Their Voices«)
3 Dilip Hiro, »Iraq’s New President Jalal Talabani: Ally of CIA, Iranian Intelligence and Saddam Hussein«, Democracy now, 7.4.2005.
4 Pepe Escobar, »What’s behind the new Iraq« und »The shadow Iraqi government« , Asia Times, 8.4.2005 bzw. 21.4.2005
5 Squabble over Iraqi militias, Asia Times, 23.4. 2005.
junge Welt vom 18.5.2005
erstellt von Frila - 25.05.2005

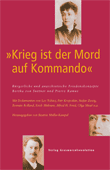
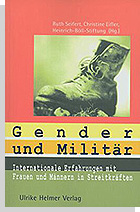


![[EFC Blue Ribbon - Free Speech Online]](http://www.efc.ca/images/efcfreet.gif)