Freispruch für Florian Pfaff könnte Signal für andere Militärs sein. Soldaten werden mit viel Geld zu Auslandseinsätzen gelockt. Ein Gespräch mit Helmuth Prieß*
F: Der 2. Wehrdienstsenat in Leipzig hat am Mittwoch die Bestrafung des Majors Florian Pfaff aufgehoben, der im Zusammenhang mit dem Irak-Krieg den Gehorsam verweigert hatte. Seine Degradierung zum Hauptmann ist damit aufgehoben. Ist das eine kleine Sensation?
Zumindest ist es sehr erfreulich. Es zeigt nicht zuletzt, daß die Wehrdienstsenate nachdenklicher geworden sind.
F: Hat eine solche Entscheidung nicht enorme Konsequenzen für künftige Militäreinsätze?
In der Tat. Schon 1999 hätten sich deutsche Soldaten nicht an dem völkerrechtswidrigen Luftangriff der NATO auf Jugoslawien beteiligen dürfen. Wir hoffen sehr, daß das Urteil im Falle Pfaff dazu beiträgt, unsere Kameraden in der Bundeswehr nachdenklich zu stimmen. Vielleicht gibt es auch dem einen oder anderen in der Bundesregierung zu denken und trägt dazu bei, daß deutsche Soldaten künftig nur nach nationalem und internationalem Recht eingesetzt werden.
F: Auf dieses Urteil könnten sich ja Wehrpflichtige berufen, die zum Beispiel im Kriegsfall US-Stützpunkte in der BRD bewachen müssen.
Ich möchte alle Wehrpflichtigen und alle Zeitsoldaten dazu aufrufen, genau das zu tun.
F: Aber auch andere Bundeswehrsoldaten könnten sich darauf beziehen, z.B. jene, die die KSK-Kräfte in Afghanistan versorgen.
Dieser Afghanistan-Einsatz ist zumindest rechtlich fragwürdig. Unabhängig davon wird das Urteil aber Signalwirkung haben. Soldaten sollten sich in rechtlich zweifelhaften Fällen von ihren Vorgesetzten erst die Rechtmäßigkeit des Befehls erläutern lassen. Geschieht das nicht, müssen sie laut Soldatengesetz den Befehl verweigern.
F: Das Leipziger Urteil dürfte für Militärpolitiker wie Peter Struck (SPD) und andere, die Deutschland plötzlich am Hindukusch verteidigen wollen, höchst blamabel sein. Wird damit nicht die gegenwärtige »Sicherheitspolitik« der Regierung torpediert?
Nach meiner Meinung müssen deutsche Soldaten friedenserhaltende Einsätze im Rahmen der UNO mittragen. Bei Kampfeinsätzen allerdings muß die Politik überdacht werden. Dieses Urteil ist daher mit Sicherheit auch ein kräftiger Tritt gegen das Schienbein des Kanzlers. Deutschland sollte Zurückhaltung bei Auslandseinsätzen praktizieren und statt dessen auf vorbeugende, nichtmilitärische Konfliktlösungen setzen.
F: Major Pfaff ist Mitglied des Darmstädter Signals. Ihre Gruppe wurde des öfteren von konservativen Politikern, aber auch vom Verteidigungsministerium attackiert. Gegen Sie persönlich hatte es Verfahren gegeben ...
Das ist richtig. Ich wurde noch stärker gemaßregelt als Pfaff. Er wurde um eine Stufe degradiert, ich gleich um zwei. Später wurde ich wieder zu meinem ursprünglichen Dienstgrad Major und dann zum Oberstleutnant befördert.
F: Welche Relevanz hat das Darmstädter Signal heute? In den Medien ist es darum still geworden.
Die Leitung des Verteidigungsministeriums schneidet uns nach wie vor. Kritische Medien, auch Rundfunk- und Fernsehanstalten, nehmen uns aber durchaus wahr. Wir nutzen die Chance, über die Öffentlichkeit auf unsere Kameraden in der Bundeswehr Einfluß zunehmen.
F: Wie sieht es mit dem Zuspruch aus?
Wir sind nach wie vor 100 Soldaten – aktive und ehemalige, wobei die letzteren in der Mehrheit sind.
Viele junge Offiziere gehen heute zur Bundeswehr, nicht um etwas für den Frieden zu tun, sondern weil sie bei Auslandseinsätzen viel Geld verdienen. Ein Leutnant im Afghanistan-Einsatz bekommt das doppelte Geld. Etwa 3000 Euro pro Monat Normalgehalt und für jeden Tag noch einmal 100 Euro. Nach einem halben Jahr hat dieser Mann mehr als 30000 Euro in der Tasche, weil es in Afghanistan kaum Gelegenheit gibt, Geld auszugeben. Ich kenne Soldaten, die sich vor ihrer Versetzung ins Ausland erst einmal einen nagelneuen BMW 316 i bestellt haben.
* Oberstleutnant a. D. Helmuth Prieß ist Sprecher des »Darmstädter Signals«, eines Arbeitskreises kritischer Soldaten (www.darmstaedter-signal.de)
Interview: Peter Wolter
junge Welt vom 23.6.2005
erstellt von Frila - 24.06.2005
Kieler Woche wird intensiv für Marinepropaganda genutzt. Protestaktion gegen die Zurschaustellung des Militarismus. Ein Gespräch mit Claas Kunze*
F: Die zur Zeit (18. bis 26. Juni) stattfindende »Kieler Woche« in Schleswig-Holsteins Landeshauptstadt ist nicht nur wie üblich ein Highlight des internationalen Segelsports, sondern auch – wie ebenfalls üblich – eine große Flottenparade. Die SDAJ hat mit einer Aktion dagegen protestiert.
Ja, wir haben an der Tirpitz-Mole, das heißt, vor Kiels Marinehafen, Transparente hochgehalten und Flugblätter verteilt. Dort liegt zur Zeit unter anderem die Fregatte »Hamburg«, das neueste und modernste Kriegsschiff der Bundesmarine. Es hat 800 Millionen Euro gekostet und wurde letztes Jahr in Dienst gestellt. Während die »Hamburg« für Besucher zur Besichtigung freigegeben ist, will die US-Navy, die ebenfalls zur Kieler Woche gekommen ist, lieber keine Zivilisten an Bord lassen. 100 Soldaten sind mit Schnellfeuerwaffen zur Bewachung aufgestellt, während einige Dutzend Meter entfernt Tausende Menschen, die üblicherweise zur Kieler Woche kommen, am Ufer entlang flanieren.
F: Ist die US-Navy stark vertreten?
Drei Schiffe haben die USA geschickt: den Zerstörer »Cole«, den Kreuzer »Anzio« und das Docklandungsschiff »Tortuga« mit »kampferprobter Marineinfanterie« an Bord, wie es zynisch heißt. Insgesamt sind 1100 Soldaten gekommen, womit die USA das größte ausländische Kontingent stellen. Auch viele andere Staaten haben Kriegsschiffe geschickt, zum Beispiel Kanada, Frankreich, Dänemark, Estland, Litauen und Spanien. Ein Teil davon hatte letzte Woche bei einem NATO-Manöver in der Ostsee den »Kampf gegen Terroristen« geprobt.
F: Was wollten Sie mit Ihrer Aktion erreichen?
Wir wollten gegen diese Zurschaustellung des Militarismus protestieren. Alle Jahre wieder wird beim sogenannten Open Ship der letzte Schrei an mörderischen Waffen stolz dem Publikum präsentiert. Wir finden, daß sich Party und Kriegsgerät nicht miteinander vertragen. Außerdem wollten wir darauf hinweisen, daß das für Rüstung ausgegebene Geld viel nötiger für Bildung gebraucht wird.
F: Wie haben die Besucher auf die Aktion reagiert?
Die meisten mit Desinteresse. Die wollten nur die Technik sehen. Einige haben uns angepöbelt, andere haben Diskussionen angefangen. Von einigen wenigen Passanten gab es auch Zustimmung, aber die wollten die Schiffe sowieso nicht besichtigen.
F: Neben den vielen Marinefahrzeugen gibt es auch eine neue Ausstellung der Bundeswehr zu ihrem 50jährigen Bestehen zu sehen.
Ja. Es sind unter anderem ein Raketenwerfer und Panzer aufgebaut, in denen kleine Kinder herumturnten. Dazu eine Reihe von Schautafeln, auf denen für die Bundeswehr geworben wird. Das Ganze ist eine Art Wanderausstellung, die zur Zeit durch die Bundesrepublik tourt. Die Bundeswehr tritt immer häufiger auf Jugendmessen, Festivals und Veranstaltungen wie der Kieler Woche auf. Man will sich den Jugendlichen, die keinen Ausbildungsplatz haben und damit rechnen müssen, in ihrem Leben nicht mehr aus den unzähligen Praktika und Warteschleifen herauszukommen, als krisensicherer Ausbilder präsentieren. Die Bundeswehr brüstet sich damit, für über 60 Berufe auszubilden. Was sie zumeist verschweigt, ist, daß eine Verpflichtung für mindestens acht Jahre Voraussetzung für eine Ausbildung bei der Bundeswehr ist. Außerdem muß man sich zu Auslandseinsätzen bereit erklären.
F: Plant die Kieler SDAJ weitere antimilitaristische Aktionen in nächster Zeit?
In Schönberg, einem größeren Dorf in der Nähe Kiels, wird es Ende Juli ein Sportfest geben, bei dem die Bundeswehr als Hauptsponsor auftritt. Dagegen werden wir sicherlich etwas machen. Außerdem ist in Lütjenburg, einer Kleinstadt in Ostholstein, demnächst eine öffentliche Rekrutenvereidigung. Auch da wird es wahrscheinlich Proteste geben.
* Claas Kunze ist Mitglied der Sozialistischen Deutschen Arbeiterjugend (SDAJ) in Kiel.
Interview: Wolfgang Pomrehn
junge Welt vom 23.6.2005
erstellt von Frila - 24.06.2005
Kompaniechef und 17 Unteroffiziere der Bundeswehr aus dem westfälischen Coesfeld müssen sich vor dem Landgericht Münster verantworten
Im Skandal um Mißhandlungen von Bundeswehr-Rekruten im westfälischen Coesfeld hat die Staatsanwaltschaft am Montag beim Landgericht Münster Anklage gegen den Kompaniechef und 17 Unteroffiziere erhoben. Sie sollen 163 Rekruten bei vier Marschübungen mit Schwachstrom, Wasser und Schlägen gefoltert haben. Die Vorwürfe gegen die Ausbilder der Coesfelder Freiherr-vom-Stein-Kaserne waren Ende Oktober 2004 bekanntgeworden. Sie sollen ihre Untergebenen bei simulierten Geiselnahmen gequält haben. Laut Aussagen wurden die Rekruten überfallen, gefesselt, und es wurde ihnen Wasser in Mund und Hosen gepumpt. Später seien Schläge, Tritte und Schwachstromstöße hinzugekommen.
Insgesamt wurde gegen 38 Beschuldigte ermittelt. Gegen 20 Personen wurde das Verfahren aber abgetrennt. Es wird angenommen, daß die Staatsanwaltschaft das abgetrennte Verfahren wegen geringer Schuld der Beteiligten einstellen wird. Nach der Vernehmung von 290 Soldaten ergab sich laut einer Mitteilung der Polizei in Münster der Verdacht, daß mit »weitgehender Billigung« des Kompaniechefs im Rahmen der allgemeinen Grundausbildung »Übungsinhalte wie Gefangennahme und Geiselhaftbefragung« mit unzulässigen Methoden durchgeführt wurden. Einige der beteiligten Unteroffiziere hätten schon an Auslandseinsätzen der Bundeswehr teilgenommen oder seien zumindest dafür ausgebildet gewesen.
Die Beschuldigten haben mit Ausnahme des Kompaniechefs im Ermittlungsverfahren die Aussage verweigert. Ihnen droht eine Verurteilung wegen Mißhandlung (Paragraph 30 Wehrstrafgesetz) und entwürdigender Behandlung (Paragraph 31 WStG) sowie wegen gefährlicher Körperverletzung gemäß Paragraph 224 StGB. Darauf stehen Freiheitsstrafen von drei Monaten bis zu fünf Jahren. Wann die Hauptverhandlung vor der 8. Großen Strafkammer des Landgerichts Münster stattfindet, steht noch nicht fest. Nach Angaben des Heerestruppenkommandos in Koblenz soll nach einem rechtskräftigen Urteil ein Truppendienstgericht über disziplinarische Schritte entscheiden. Das mögliche Strafmaß reiche vom Verweis bis zur Entlassung, sagte der Sprecher des Kommandos, Withold Pieta, am Dienstag.
Der Vertreter der Anklagebehörde, Oberstaatsanwalt Wolfgang Schweer, erklärte am selben Tag, die Übungen seien in Inhalt und Form absolut aus dem Ruder gelaufen. »Ich denke, das Problem liegt in der Führung der Kompanie«, so Schweer. Diese Betrachtungsweise unterstützt die Absicht des Bundesverteidigungsministeriums, den Skandal von Coesfeld als Einzelfall hinzustellen. Dabei wird ausgeblendet, daß das Verhalten der jetzt angeklagten Ausbilder auf eine allgemeine Tendenz zur Verrohung aufgrund der Militarisierung der deutschen Politik zurückgeht. Ganz offenkundig haben sich die Ausbilder bei ihrem entwürdigenden Verhalten an US-amerikanischen Vorbildern orientiert. Guantanamo und Abu Ghraib entfalten eine verheerende Fernwirkung. In den Köpfen junger Soldaten scheint sich festzusetzen, daß ein Verhalten, dessen sich die befreundete Supermacht USA befleißigt, nicht so schlimm sein kann.
Hinzu kommt die ständige Relativierung der Grundrechte durch die SPD-Grünen-Bundesregierung in den vergangenen Jahren. Meist unter dem Vorwand der Terrorismusbekämpfung wurden durch die Gesetzespakete Schily I und II, zu Lauschangriff und DNA-Speicherung die Bürgerrechte systematisch eingeschränkt. Damit geht einher, daß das allgemeine Bewußtsein für diese Grundwerte schwindet. Speziell die Debatte nach der Ermordung des Bankierssohns Jakob von Metzler in Frankfurt am Main hat gezeigt, wie schnell Politiker, Juristen und andere Personen des öffentlichen Lebens zu einer Aufweichung des bisherigen absoluten Folterverbots bereit sind. So auch der Bundeswehr-Hochschulprofessor Michael Wolffssohn. Mittlerweile regt sich fast niemand mehr darüber auf, daß bereits drei (!) juristische Fachbücher zur Auslegung des Grundgesetzes Folter in bestimmten Fällen für zulässig halten. Daher ist Coesfeld kein Einzelfall, sondern Ausdruck einer gesellschaftlichen Entwicklung der Entsolidarisierung und des Verlusts an Humanität.
Ulla Jelpke
junge Welt vom 22.6.2005
erstellt von Frila - 24.06.2005
Irak-Konferenz in Brüssel wirbt für Demokratie und Stabilität. Im US-Besatzungsgebiet verbreiten Todesschwadronen derweil Angst und Schrecken
Washington sucht händeringend Unterstützung für das Vorgehen im Irak. Bizarr dabei ist: Während George W. Bush in den USA ob der mittlerweile mehr als 1700 getöteten GIs im eigentlich doch »befreiten« Zweistromland immer mehr an Unterstützung verliert, wird die Besatzungspolitik des US-Präsidenten international zunehmend goutiert. Erklärtes Ziel der internationalen Irak-Konferenz in Brüssel am morgigen Mittwoch etwa ist die »weitere Stabilisierung« des Besatzungsgebietes und die Unterstützung des »Demokratisierungsprozesses«. Vertreter aus mehr als 80 Ländern und unzähliger Nichtregierungsorganisationen wollen an dem von der EU gesponserten Treffen teilnehmen. Die neue Übergangsregierung in Bagdad soll ein Forum erhalten, um internationale Anerkennung und Unterstützung zu erlangen. Mit anderen Worten, in Brüssel soll die Fassade gestärkt werden, die die USA vor ihr Besatzungsregime zu stellen versuchen. Allein die sonst chronisch pleite EU will dazu weitere 200 Millionen Euro beisteuern.
Drei US-Offensiven
Die Iraker selbst sind von Sicherheit und Demokratie entfernter denn je. Mit drei Offensiven versucht die US-Armee dieser Tage, wieder Herr der Dinge im Irak zu werden. Die »Operation Speer« konzentriert sich auf den äußersten Westen der Provinz Anbar, speziell die Grenzregion zu Syrien; mit der »Operation Dolch« gehen US-Truppen nach eigenen Angaben gegen Ausbildungs- und Waffenlager in einem Sumpfgebiet am Tharthar-See nordwestlich von Bagdad vor; »Operation Weißes Schild« schließlich konzentriert sich auf den Zentral- und Südirak.
In diesem Monat erschienen gleich mehrere Berichte von UN- und Menschenrechtsorganisationen, die allesamt ein verheerendes Bild von den Verhältnissen im Irak seit Bushs Machtübernahme in Bagdad zeichnen. Eindringlich warnte das UN-Entwicklungsprogramm (UNDP) in einer Studie, wie dramatisch sich die Lebensbedingungen seit Kriegsbeginn verschlechtert haben (siehe jW vom 18./19. Juni).
Der am 7. Juni präsentierte Quartalsbericht von UN-Generalsekretär Kofi Annan warnte ebenso wie die Analysen von Amnesty International und des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) vor Justizwillkür: Danach sind im Irak mehrere tausend Menschen widerrechtlich eingesperrt, ohne Rechtsbeistand und die Möglichkeit, sich vor Gericht zu rechtfertigen. Die US-Truppen und irakische Einheiten werden für die Anwendung »exzessiver Gewalt« an Checkpoints sowie bei Hausdurchsuchungen scharf kritisiert.
Die gefürchtete Polizei
Neben den regulären Armeen und Polizeikräften im Dienste der US-Besatzer sind unter der Ägide von Expremier Ijad Allawi zudem mehrere paramilitärische Einheiten aufgebaut worden. Die wichtigsten dabei sind die »Special Police Commandos« (SPC), die stark an die rechten kolumbianischen Todesschwadronen erinnern (siehe dazu junge Welt vom 19.5.2005). Pate beim Aufbau standen US-Berater, die in Süd- und Mittelamerika Erfahrungen im »schmutzigen Krieg« gegen Befreiungsbewegungen gesammelt hatten.
Diese Milizen wurden schnell berüchtigt für ihre Brutalität. Und: Seit Aufstellung der Sonderpolizeieinheiten mußten zahlreiche Morde konstatiert werden – und ausgerechnet in den Gebieten, in denen die SPC operativ eingesetzt waren. Am deutlichsten wurde dies in der nordirakischen Stadt Mosul, wo die Todesschwadron seit Ende Oktober aktiv ist. Bei Razzien wurden dort Dutzende Männer im waffenfähigen Alter gefangengenommen. Augenzeugen berichteten, wie diese gefesselt und mit verbundenen Augen abgeführt und nicht wieder gesehen wurden. In den darauffolgenden Wochen wurden in der Region mehr als 150 Leichen von Männern gefunden, die meisten durch Kopfschuß exekutiert. Die US-Truppen behaupteten in ihren Kommuniquees, es würde sich um Angehörige der irakischen Hilfstruppen handeln. Doch trugen alle Opfer zivile Kleidung, und sie waren schwer zu identifizieren.
Ähnliche Vorfälle wurden aus der Gegend um Samarra sowie aus den Orten Suwayra, Mardaen und Al Kaim kurz nach Beginn der »US-Operation Blitz« gemeldet. In Bagdad führte eine Welle von Morden mittlerweile zu konkreten Anklagen gegen die neuen irakischen Sicherheitskräfte, insbesondere die SPC. Anfang Mai war in der irakischen Hauptstadt ein Massengrab mit 14 Toten gefunden worden. In diesem Fall konnten Familien die Opfer identifizieren. Allesamt waren sie Bauern, die bei einer Razzia auf einem Gemüsemarkt gefangengenommen worden waren.
Joachim Guilliard / Rüdiger Göbel
junge Welt vom 21.6.2005
erstellt von Frila - 24.06.2005
Die geistige Mobilmachung in den USA gegen Nordkorea hat erst begonnen. Scharfmacher mit liberalen Feigenblättern
Für die aktuelle Zurückhaltung der US-Regierung gegenüber Nordkorea gibt es neben der Weigerung Seouls und Pekings, Druck auf Pjöngjang auszuüben, noch einen weiteren Grund. Für einen Krieg muß auch im eigenen Land zuerst ausreichend Stimmung gemacht werden. Damit haben die rechten Unterstützer von US-Präsident George Bush gerade erst begonnen.
Wie die New York Times unter Berufung auf das Umfeld des US-Präsidenten berichtete, las Bush in diesem Frühjahr auf Empfehlung Henry Kissingers »Die Aquarien von Pjöngjang« von Kang Chol Hwan. Kang berichtet darin von seinen Erfahrungen im Arbeitslager Yodok, in dem er zehn Jahre seiner Kindheit verbrachte. In Nordkorea gilt Sippenhaftung – analog zur Vorstellung von der Familie als Kern der Gesellschaft. Die gegenseitige Unterstützung durch Familienangehörige sorgt dafür, daß viele die Strapazen der Gefangenschaft überleben. Richtig gelesen zeigt Kangs Buch, daß den Gefangenen viel Raum zur Improvisation gelassen wird. So brannte etwa sein Onkel, der lange Jahre in einer Brauerei gearbeitet hatte, nach kurzer Zeit seinen eigenen Schnaps, was ihm große Vorteile verschaffte. Zudem wird deutlich, daß der Aufenthalt in einem Arbeitslager den Gefangenen nach der Freilassung weder den Umzug in die Nähe der Hauptstadt verbaut noch ein Hindernis für den Besuch einer Hochschule darstellt.
Rechte Einpeitscher
Davon wird nicht die Rede sein, wenn Kang im Juli nach Washington kommt, denn seine Gastgeber setzen nicht auf eine differenzierte Darstellung. Danach wollen ihn evangelikale Christen auf US-Tour schicken. Mit im Programm: eine Ansprache beim Musikfestival »Rock the Desert« in Bushs Heimatort Midland, Texas. Für die »Menschenrechte in Nordkorea« engagiert sich nahezu die gesamte erste Liga des christlichen Fundamentalismus in den USA. In der North Korea Freedom Coalition (NKFC) finden sich neben obskuren Exilantengruppen und der Heilsarmee die National Association of Evangelicals, die schwulenfeindliche American Family Association, die vom Fernsehprediger Pat Robertson gegründete Christian Coalition, die rechte Denkfabrik Defense Forum Foundation und Helping Hands Korea, ein Ableger der Sekte Children of God, die heute unter dem Namen The Family firmiert.
Bedauerlicherweise ebenfalls dabei: das Simon Wiesenthal Center. „Wo bleibt der weltweite Aufschrei?«, fragte dessen stellvertretender Direktor, Abraham Cooper, am 6. Juni in der Süddeutschen Zeitung. Staatsfeinde würden in Nordkorea für Experimente mißbraucht, um neue Generationen chemischer und biologischer Waffen zu entwickeln. Einzige Quelle: nordkoreanische Überläufer, die in der Vergangenheit zu jeder Aussage bereit waren, die in Seoul gerade benötigt wurde. Cooper bringt die angebliche »Vergasung politischer Gefangener« in Nordkorea sogleich in Beziehung mit dem Massenmord an den europäischen Juden. Auch dieser sei von den Medien zunächst ignoriert worden. Zugleich liefert er mit »geschätzte 200000« einen neuen Rekordwert für die Zahl der politischen Gefangenen in der Demokratischen Volksrepublik Korea. Wer diese Schätzung abgegeben hat, läßt Cooper offen. Neben dem Wiesenthal- Center dient die Commission on Social Action of Reform Judaism den in der NKFC versammelten Bush-Kriegern als liberales Feigenblatt.
Realitäten ignoriert
Da spielt es keine Rolle, daß Nordkoreas Staatschef Kim Jong Il soeben im Gespräch mit dem südkoreanischen Wiedervereinigungsminister Chung Dong Young die Wiederaufnahme der Sechsergespräche (mit China, Japan, Rußland, Südkorea und den USA) über das Atomprogramm seines Landes bereits für Juli in Aussicht gestellt hat. Chung hatte dies nach seiner Rückkehr von den Feierlichkeiten zum fünften Jahrestag des Gipfeltreffens zwischen Kim Jong Il und Kim Dae Jung am Wochenende mitgeteilt, das die »Sonnenscheinpolitik« des Südens gegenüber dem Norden einläutete. Anders als etwa gegenüber China oder Südafrika zur Zeit der Apartheid ist »Wandel durch Handel« im Fall Nordkorea für die US-Rechte kein Thema. Ihr bisher größter Sieg: der »North Korea Human Rights Act«, den der US-Kongreß im Oktober vergangenen Jahres verabschiedete. Durch das Gesetz wurden weitere Mittel für die psychologische Kriegsführung gegen die Volksrepublik zur Verfügung gestellt.
So ist auch auf der Ebene der Popkultur viel passiert, seit James Bond vor zwei Jahren in »Die Another Day« einem nordkoreanischen Offizier, der sich in den Besitz von Massenvernichtungswaffen bringen wollte, den Garaus machte. Der Atomreaktor von Yongbyon ist zum beliebten Angriffsziel für Computerspiel-Piloten geworden. Kim Jong Il hat sich als Bösewicht in Hollywood etabliert.
Inzwischen sehen die US-Amerikaner Meinungsumfragen zufolge abwechselnd Iran und Nordkorea als größte Bedrohung. Trotzdem sprachen sich in der letzten Gallup-Umfrage aber 62 Prozent der Befragten gegen ein militärisches Vorgehen in Nordkorea aus. Die geistige Mobilmachung hat, wie gesagt, eben erst begonnen.
Josef Oberländer, Seoul
junge Welt vom 20.6.2005
erstellt von Frila - 24.06.2005
Schily und Struck planen schon konkret für ständige Auslandseinsätze der Bundespolizei
Die Pläne der Bundesregierung, den Bundesgrenzschutz (BGS) verstärkt als Hilfstruppe bei Militäreinsätzen der Bundeswehr im Ausland einzusetzen, sind bereits weit gediehen. Vor einigen Tagen war bekanntgeworden, daß Bundesverteidigungsminister Peter Struck und Bundesinnenminister Otto Schily (SPD) der Meinung sind, bei den militärischen Interventionen im Ausland würden immer mehr polizeiliche Aufgaben anfallen. Diese sollte am besten die Bundespolizei (bisher BGS) wahrnehmen. Nunmehr meldete der Spiegel, Schily habe schon den Aufbau einer Hundertschaft im niedersächsischen Gifhorn beschlossen, die ab Januar kommenden Jahres Polizeieinsätze im Ausland übernehmen solle.
Die politische Entwicklung der vergangenen Jahre hätte den BGS beinahe überflüssig gemacht. Im Rahmen des Schengener Abkommens sind 1990 zunächst die Grenzkontrollen zu den westlichen Nachbarstaaten der BRD weggefallen, später zu Österreich und künftig (nach der Volksabstimmung vom 12. Juni zur Schweiz. Die EU-Osterweiterung sah zwar nach dem Beitritt Tschechiens und Polens am 1. Mai 2004 noch die Fortsetzung von Grenzkontrollen vor, aber auch diese werden in zwei bis drei Jahren aufgehoben.
Als Ersatz für seine alte Aufgabe der »Grenzsicherung« bekam der BGS noch unter Innenminister Manfred Kanther (CDU) 1998 die Befugnis, auf Bahnstrecken und Bahnhöfen sowie auf Autobahnen im Inland sogenannte verdachtsunabhängige Kontrollen durchzuführen. Diese Einführung der Schleierfahndung ist ein weiterer Schritt mehr in den Überwachungsstaat gewesen, lastet aber arbeitsmäßig den BGS nicht aus. Schilys alter Traum, eine Art deutsches FBI zu schaffen, blieb ebenfalls unerfüllt, da die Bundesländer auf ihre überkommene Zuständigkeit für das Polizeirecht pochen. Daher sucht man krampfhaft nach neuen Aufgaben. Die Umbenennung in »Bundespolizei« im Mai 2005 war der Auftakt, denn damit wollte Schily klarstellen, daß der BGS nicht mehr auf die ehemaligen Aufgaben an den Außengrenzen der BRD reduziert wird.
Nun wird deutlich, wohin die Reise gehen soll. Das Wort »Germans to the front« bezieht sich künftig nicht mehr allein auf Soldaten, sondern auch auf die Polizisten des Bundes. Hierzu erklärte Monty Schädel, Bundessprecher der (DFG-VK): »Die vermeintlichen ›Polizeieinsätze‹ im Ausland sind ein deutliches Indiz für die rasch zunehmende Militarisierung der Innen- und Außenpolitik dieser Regierung. Aber auch bei einem Regierungswechsel ist keine Änderung in der Militarisierungsfrage zu erwarten. Angestrebt wird eine erhöhte militärische Interventionsfähigkeit.« Wenn dieses Vorhaben umgesetzt werde, müsse den Bundespolizisten grundsätzlich auch ein Recht auf Kriegsdienstverweigerung nach Artikel 4 des Grundgesetzes zustehen. Aber die DFG-VK lehnt Strucks und Schilys Pläne ohnehin ab. »Aus unserer Sicht sind die Einsätze nicht Grundgesetzkonform«, erklärte der politische Geschäftsführer der Vereinigung, Joachim Thommes. Auch die Absicherung von Checkpoints durch bewaffnete Verbände sei in Wahrheit ein Militäreinsatz. Es gebe eine gefährliche Tendenz hin zur Durchführung noch größerer Militäreinsatze. »Hierfür wird momentan der mentale Boden bereitet«, kommentierte die DFG-VK.
Diese Entwicklung läuft bereits einige Jahre. So hat der BGS schon seit 1989 mit insgesamt mehr als 1600 Beamten an internationalen Militäreinsätzen teilgenommen. Derzeit versehen 137 deutsche Polizisten auf dem Balkan, in Afrika und Afghanistan ihren Dienst. Bisher soll sich das Innenministerium aber noch gegen Vorstellungen des Verteidigungsministeriums wehren, die Bundespolizei nach dem Vorbild der italienischen Carabinieri als paramilitärische Truppe aufzubauen. Dazu würde eine Ausrüstung mit Maschinengewehren und Stahlhelmen gehören, die der BGS vor Jahren abgeschafft hat.
Ulla Jelpke
junge Welt vom 20.6.2005
erstellt von Frila - 24.06.2005
Washington hat aus dem Vietnamkrieg keine Lehren gezogen. Das zeigt sich heute vor allem im Irak
Es ist mehr als 30 Jahre her, daß US-Helikopter, vom Abwehrfeuer getroffen in das Südchinesischen Meer stürzten oder hektisch die Evakuierung der letzten kolonialen Außenposten in Saigon durchführten, während in den Hauptstraßen schon die Panzer der Nationalen Befreiunsgfront rollten und die südvietnamesische Stadt einnahmen. In den Medien sind schon oft die »Lehren, die aus Vietnam gezogen wurden«, thematisiert worden, aber in diesen Tagen drängt sich mehr und mehr die Frage auf: Welche Lehren sollen das sein?
Wurde zum Beispiel gelernt, daß es unmöglich ist, anderen Völkern Marionettenregierungen vor die Nase zu setzen? Der damalige US-Präsident Lyndon B. Johnson gab dem südvietnamesischen Premier Nguyen Cao Ky und General Nguyen Van Thieu höchstpersönlich das Versprechen, die USA würden ihr Militärregime stützen, und inszenierte eine Wahl, um das Regime mit demokratischen Weihen auszustatten. Am 4. September 1967 berichtete die New York Times darüber, wie »überrascht« die USA über den guten Verlauf der Wahlen waren: »Offizielle US-Vertreter zeigten sich heute überrascht und ermutigt über den positiven Ausgang der südvietnamesischen Präsidentschaftswahlen, die trotz der Terrorkampagne des Vietcong stattfand, der die Wahl verhindern wollte. Laut Berichten aus Saigon gaben gestern 83 Prozent der 5, 85 Millionen registrierten Wähler ihre Stimme ab. Viele von ihnen gingen das Risiko ein, Opfer der vom Vietcong angedrohten Repressalien zu werden.«
Überraschend, wie aktuell diese Worte heute, 38 Jahre später, klingen! Man braucht nur das Wort »Vietnam« durch »Irak« zu ersetzen und »Vietcong« durch »Islamisten« – und schon könnte der Artikel aus einer Zeitung dieser Tage stammen. Wenn dem aber so ist, welche Lehren sollen dann aus Vietnam gezogen worden sein?
Wir erleben nichts anderes als das Echo aus vergangenen Tagen, nur mit neu aufbereiteten Lügen, die wieder und wieder dazu benutzt werden, die junge Generation für das Imperium in den Kampf zu schicken, um Korruption von Staat und Wirtschaft daheim und den Massenmord an überfallenen Völkern unter Einsatz ihres Lebens zu verteidigen.
Haben die Medien aus der damaligen Erfahrung etwa die Lehre gezogen, daß sie nicht einfach blind dem Diktat von Militär und Regierungsvertretern folgen dürfen, wenn es um Fragen von Krieg und Frieden geht? Haben die Verantwortlichen in Kunst und Kultur etwa gelernt, daß es wichtig ist, seinen Willen nicht den Stimmungsschwankungen im Lande zu unterwerfen? Hat die Justiz etwa gelernt, daß Krieg immer der Feind der Freiheit ist und daß es falsch ist, mit der geballten Polizeimacht gegen große Bevölkerungsgruppen vorzugehen, weil sie aus ethnischen und religiösen Motiven gegen den Krieg sind? Haben Politiker etwa gelernt, daß man Kriege nicht auf der Basis von Lügengespinsten entfesseln darf?
Welche Lehren wurden also wirklich aus dem Vietnamkrieg gezogen? Nicht eine einzige! Und weil nichts aus der Geschichte gelernt wurde, fahren wir fort, von einer Katastrophe in die nächste zu stolpern und immer wieder in die Falle des Imperiums zu tappen, dessen Verfechter meinen, ihnen komme die heilige Aufgabe zu, über andere Völker zu herrschen.
Gore Vidal, der zurecht als ein Weiser dieses Landes angesehen wird, spricht äußerst kritisch über die heutige Zeit und welche Zukunft in ihr erkennbar ist. In einem Interview, das er vor kurzem den City Pages in Minneapolis gab, erklärte er: »Wir können sagen, daß die alte amerikanische Republik samt und sonders tot ist. Es hat sich gezeigt, daß die Institutionen, von denen wir dachten, daß sie ewig bestehen würden, dies nicht tun. Und das trifft auf die drei Gewalten der Regierung ebenso zu wie auf die Grundverfassung des Staates, die Bill of Rights. Wir befinden uns also auf unbekanntem Territorium. Wir werden von Public-Rela-tions-Managern regiert. Dank der korrupten Haltung und/oder der Unfähigkeit der Medien erhält die Bevölkerung nur unzureichende Informationen.«
In seiner ablehnenden Bewertung des Irak-Krieges war Vidal nicht weniger scharf: »Irak ist ein Symptom, nicht das eigentliche Problem. Es ist ein Symptom unserer Gier nach Öl, das eine nicht erneuerbare Ressource dieser Welt ist. Alternativen könnten gefunden werden, aber sie werden so lange nicht gefunden, wie noch ein Tropfen Öl oder ein Kubikzentimeter Erdgas aus anderen Ländern herausgesaugt werden kann, vorzugsweise unter Anwendung von Gewalt durch die Regierungsjunta, die im Moment über unsere Angelegenheiten entscheidet. Der Irak-Krieg wird mit unserer Niederlage enden.«
(Übersetzung: Jürgen Heiser)
junge Welt vom 18.6.2005
erstellt von Frila - 24.06.2005

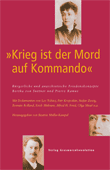
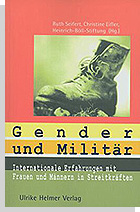


![[EFC Blue Ribbon - Free Speech Online]](http://www.efc.ca/images/efcfreet.gif)