Das Ende der Friedfertigkeit
Frauen an der Waffe - die Unterwanderung einer Männerkultur? Ein international angelegter Sammelband unterzieht frauenfeindliche Vorurteile und pazifistisch-feministische Hoffnungen einer Revision
VON ULRIKE BAUREITHEL
Während wir von den nachge"spielten" Misshandlungen in der Bundeswehr hören, haben wir gleichzeitig noch die verstörenden Bilder aus Abu Ghraib in Erinnerung: die 21-jährige Reservistin Lynndie England, die irakische Gefangene sexuell demütigt. Hätte an ihrer Stelle ein Mann vor der Kamera posiert, der Skandal wäre nur halb so groß gewesen. Doch eine Frau, die für "weibliche Friedfertigkeit" steht und - als Soldatin - für die friedensstiftende Seite des Krieges, im Mittelpunkt eines derart unwürdigen Gewaltexzesses? Das erschüttert nicht nur die gepflegten Wahrnehmungsmuster, sondern setzt auf eine ganz neue Weise das Thema Frauen und Militär auf die Tagesordnung. Mit dem Eintritt von Frauen in die militärische Männerdomäne war schließlich auch einmal die Hoffnung verbunden, diese zu demokratisieren.
Frauen in Uniform und mit der Waffe in der Hand sind keine Aus-nahmeerscheinung mehr. Selbst in der Bundesrepublik haben wir uns, wenn auch mit einiger Verzögerung und erst durch das Urteil des Europäischen Gerichtshofes im Jahre 2000 angestoßen an Soldatinnen gewöhnt. Die lange Debatte in den siebziger und achtziger Jahren - die Frage, ob Frauen überhaupt Waffendienst tun sollen - ist ausdiskutiert bzw. von der Wirklichkeit überholt: Die friedensbewegt-feministischen bzw. frauenfeindlichen Argumente und Bedenken sind stumpf geworden angesichts einer jüngeren Frauengeneration, die die Streitkräfte als selbstverständliches Berufsfeld betrachtet und gleiche Karrierechancen fordert. Nun haben zwei Fachfrauen, Ruth Seifert und Christine Eifert, diese von Frauen "unterwanderte" Männerkultur einer vorläufigen Inspektion unterzogen: Wie integrieren sich Frauen in die Armee, und welche Auswirkungen hat ihre Präsenz auf die militärische Kultur? Wie ist der Umgang zwischen Soldaten und Soldatinnen, gibt es tatsächlich gleiche Aufstiegsmöglichkeiten und wie nehmen die Streitkräfte bzw. die Öffentlichkeit Frauen an der Waffe wahr?
Schwächung männlicher Kampfkraft
Was die Herausgeberinnen in ihrem Sammelband Gender und Militär präsentieren, zeitigt Erwartbares, aber auch Überraschendes. Wenig erstaunlich ist beispielsweise, dass der Nachweis eines "weiblichen Arbeitsvermögens" im Hinblick auf militärische Dienste bislang noch immer aussteht und die Integrationsgegner bzw. Karrierebremser deshalb zunehmend mit der "Schwächung männlicher Kampfkraft" argumentieren, um zu verhindern, dass Frauen an Kampfhandlungen beteiligt werden bzw. in die Kommandozentralen aufsteigen. Folgerichtig bemühen sich die meisten Länder weiterhin, Frauen, obwohl diese gleichberechtigt in die Armee aufgenommen werden, von der Kampfzone fern zu halten. Ein sowohl definitorisch als auch praktisch problematisches Unterfangen, weil "kampf-ferne" Verwendungen unvermittelt umschlagen können und gerade die "Etappe" - man denke an die Versorgungseinheiten im Irakkrieg - zum umkämpften Truppenteil werden kann.
Sensationell ist auch nicht der fast durchweg konstatierte Befund, dass es Frauen im Militär mit dem Aufstieg in die höheren Ränge noch viel schwerer haben als im zivilen Leben: In den obersten Führungsschichten sind Frauen Exotinnen; selbst in den mittleren Chargen findet man sie vergleichsweise selten. Das ist in Israel, wo als einzigem westlich orientierten Land Frauen dienstpflichtig sind, ebenso wie in Russland oder Japan. Interessant am Fall Israel ist aber, wie Orna Sasson-Levy zeigt, dass die potentielle Möglichkeit für Frauen, sich im Militär als "Staatsbürgerinnen" zu beweisen, keineswegs emanzipatorische Wirkungen hat, eher im Gegenteil. Gerade die rigide Genderpolitik des Militärs reproduziert, so ihr Ergebnis, die in der Gesellschaft gültigen hierarchischen und essentialistischen Wahrnehmungen von Männlichkeit und Weiblichkeit.
Gender in der japanischen Armee
Ganz anders in Japan, wo, wie Sabine Frühstück nachzeichnet, Frauen nur eine von mehreren Genderfiguren in der Jieitai, der japanischen Armee, darstellen. Ein Grund liegt vor allem darin, dass die japanische Armee historisch so kompromittiert ist, dass diese gezwungen ist, nach neuen Orientierungen zu suchen. Die Integration von Frauen und ihre öffentliche Darstellung ist offenbar eine wirkungsvolle Strategie der Jieitai, sich wie jede andere japanische Organisation zu präsentieren. Dass die Rekrutierung von Soldatinnen auch schlichte Notwendigkeit war, nachdem im Wirtschaftswunder immer weniger Männer ihre Zukunft in der Armee suchten, ist dabei keine japanische Besonderheit; auch das nachsowjetische Russland füllt seine Linien mit Frauen auf und verbessert damit das Image der Armee.
Die Interviews, die Christine Eifler mit russischen Soldatinnen geführt hat, gehören (zusammen mit den O-Tönen von israelischen Dienstpflichtigen) zu den Höhepunkten dieses ansonsten zu sehr auf Wahrnehmungen und Bilder orientierten Sammelbandes. Aus der Perspektive der Betroffenen erfährt man vom weiblichen Alltag in einer Armee, von den Gründen, sich als Frau zu verdingen, von ihren Vorstellungen von "Dienst" und "Disziplin" und ihren Auffassungen, wie "Frauen nach Frauenart" und "Männer nach Männerart" zu behandeln seien. Zur Sprache kommt auch der alltägliche Sexismus, der jedoch bagatellisiert wird, denn "Sexobjekt" zu sein verträgt sich nicht mit der Rolle als aktive Soldatin. Die Verdrängung sexistischer Erfahrungen ist nicht nur typisch für russische Soldatinnen, sondern ein länderübergreifendes Phänomen.
Wenn, wie Edna Levy, die zweite Berichterstatterin für Israel, schreibt, die Demokratisierung der Armee ein Indiz für die Demokratisierung der Gesellschaft ist, dann steht es mit letzterer in den etwas willkürlich gewählten, vorgestellten Ländern (USA, Großbritannien, Israel Deutschland, Ungarn, Russland, China, Japan) nicht allzu gut; auch dort nicht, wo das sozialistische Gleichheitspostulat wie in China (das historisch übrigens interessanteste Beispiel) noch offiziell gilt.
Die Koppelung von staatsbürgerlichem Status und Militärdienst ist, wie der theoretisch am weitesten ausgreifende Beitrag von Francine D'Amico vorführt, ohnehin ideologisch, weil aus dem kämpfenden Soldat nicht notwendig ein gleichberechtigter Bürger wird. Ob das Militär allerdings von innen heraus, sozusagen durch den weiblichen Gang durch die Institution, demokratisiert werden kann, wie es in manchen Beiträgen gelegentlich aufscheint, sei dahingestellt. Man muss den Fall Lynndie England nicht unbedingt symptomatisch deuten; doch die von den Autorinnen dokumentierten Tatsachen lassen wenig Spielraum für Illusionen.
Ruth Seifert/Christine Eifler/Heinrich-Böll-Stiftung (Hrsg.): Gender und Militär. Internationale Erfahrungen mit Frauen und Männern in den Streitkräften. Ulrike Helmer Verlag, Königstein/Ts. 2004, 312 Seiten, 24,95.
VON ULRIKE BAUREITHEL
Während wir von den nachge"spielten" Misshandlungen in der Bundeswehr hören, haben wir gleichzeitig noch die verstörenden Bilder aus Abu Ghraib in Erinnerung: die 21-jährige Reservistin Lynndie England, die irakische Gefangene sexuell demütigt. Hätte an ihrer Stelle ein Mann vor der Kamera posiert, der Skandal wäre nur halb so groß gewesen. Doch eine Frau, die für "weibliche Friedfertigkeit" steht und - als Soldatin - für die friedensstiftende Seite des Krieges, im Mittelpunkt eines derart unwürdigen Gewaltexzesses? Das erschüttert nicht nur die gepflegten Wahrnehmungsmuster, sondern setzt auf eine ganz neue Weise das Thema Frauen und Militär auf die Tagesordnung. Mit dem Eintritt von Frauen in die militärische Männerdomäne war schließlich auch einmal die Hoffnung verbunden, diese zu demokratisieren.
Frauen in Uniform und mit der Waffe in der Hand sind keine Aus-nahmeerscheinung mehr. Selbst in der Bundesrepublik haben wir uns, wenn auch mit einiger Verzögerung und erst durch das Urteil des Europäischen Gerichtshofes im Jahre 2000 angestoßen an Soldatinnen gewöhnt. Die lange Debatte in den siebziger und achtziger Jahren - die Frage, ob Frauen überhaupt Waffendienst tun sollen - ist ausdiskutiert bzw. von der Wirklichkeit überholt: Die friedensbewegt-feministischen bzw. frauenfeindlichen Argumente und Bedenken sind stumpf geworden angesichts einer jüngeren Frauengeneration, die die Streitkräfte als selbstverständliches Berufsfeld betrachtet und gleiche Karrierechancen fordert. Nun haben zwei Fachfrauen, Ruth Seifert und Christine Eifert, diese von Frauen "unterwanderte" Männerkultur einer vorläufigen Inspektion unterzogen: Wie integrieren sich Frauen in die Armee, und welche Auswirkungen hat ihre Präsenz auf die militärische Kultur? Wie ist der Umgang zwischen Soldaten und Soldatinnen, gibt es tatsächlich gleiche Aufstiegsmöglichkeiten und wie nehmen die Streitkräfte bzw. die Öffentlichkeit Frauen an der Waffe wahr?
Schwächung männlicher Kampfkraft
Was die Herausgeberinnen in ihrem Sammelband Gender und Militär präsentieren, zeitigt Erwartbares, aber auch Überraschendes. Wenig erstaunlich ist beispielsweise, dass der Nachweis eines "weiblichen Arbeitsvermögens" im Hinblick auf militärische Dienste bislang noch immer aussteht und die Integrationsgegner bzw. Karrierebremser deshalb zunehmend mit der "Schwächung männlicher Kampfkraft" argumentieren, um zu verhindern, dass Frauen an Kampfhandlungen beteiligt werden bzw. in die Kommandozentralen aufsteigen. Folgerichtig bemühen sich die meisten Länder weiterhin, Frauen, obwohl diese gleichberechtigt in die Armee aufgenommen werden, von der Kampfzone fern zu halten. Ein sowohl definitorisch als auch praktisch problematisches Unterfangen, weil "kampf-ferne" Verwendungen unvermittelt umschlagen können und gerade die "Etappe" - man denke an die Versorgungseinheiten im Irakkrieg - zum umkämpften Truppenteil werden kann.
Sensationell ist auch nicht der fast durchweg konstatierte Befund, dass es Frauen im Militär mit dem Aufstieg in die höheren Ränge noch viel schwerer haben als im zivilen Leben: In den obersten Führungsschichten sind Frauen Exotinnen; selbst in den mittleren Chargen findet man sie vergleichsweise selten. Das ist in Israel, wo als einzigem westlich orientierten Land Frauen dienstpflichtig sind, ebenso wie in Russland oder Japan. Interessant am Fall Israel ist aber, wie Orna Sasson-Levy zeigt, dass die potentielle Möglichkeit für Frauen, sich im Militär als "Staatsbürgerinnen" zu beweisen, keineswegs emanzipatorische Wirkungen hat, eher im Gegenteil. Gerade die rigide Genderpolitik des Militärs reproduziert, so ihr Ergebnis, die in der Gesellschaft gültigen hierarchischen und essentialistischen Wahrnehmungen von Männlichkeit und Weiblichkeit.
Gender in der japanischen Armee
Ganz anders in Japan, wo, wie Sabine Frühstück nachzeichnet, Frauen nur eine von mehreren Genderfiguren in der Jieitai, der japanischen Armee, darstellen. Ein Grund liegt vor allem darin, dass die japanische Armee historisch so kompromittiert ist, dass diese gezwungen ist, nach neuen Orientierungen zu suchen. Die Integration von Frauen und ihre öffentliche Darstellung ist offenbar eine wirkungsvolle Strategie der Jieitai, sich wie jede andere japanische Organisation zu präsentieren. Dass die Rekrutierung von Soldatinnen auch schlichte Notwendigkeit war, nachdem im Wirtschaftswunder immer weniger Männer ihre Zukunft in der Armee suchten, ist dabei keine japanische Besonderheit; auch das nachsowjetische Russland füllt seine Linien mit Frauen auf und verbessert damit das Image der Armee.
Die Interviews, die Christine Eifler mit russischen Soldatinnen geführt hat, gehören (zusammen mit den O-Tönen von israelischen Dienstpflichtigen) zu den Höhepunkten dieses ansonsten zu sehr auf Wahrnehmungen und Bilder orientierten Sammelbandes. Aus der Perspektive der Betroffenen erfährt man vom weiblichen Alltag in einer Armee, von den Gründen, sich als Frau zu verdingen, von ihren Vorstellungen von "Dienst" und "Disziplin" und ihren Auffassungen, wie "Frauen nach Frauenart" und "Männer nach Männerart" zu behandeln seien. Zur Sprache kommt auch der alltägliche Sexismus, der jedoch bagatellisiert wird, denn "Sexobjekt" zu sein verträgt sich nicht mit der Rolle als aktive Soldatin. Die Verdrängung sexistischer Erfahrungen ist nicht nur typisch für russische Soldatinnen, sondern ein länderübergreifendes Phänomen.
Wenn, wie Edna Levy, die zweite Berichterstatterin für Israel, schreibt, die Demokratisierung der Armee ein Indiz für die Demokratisierung der Gesellschaft ist, dann steht es mit letzterer in den etwas willkürlich gewählten, vorgestellten Ländern (USA, Großbritannien, Israel Deutschland, Ungarn, Russland, China, Japan) nicht allzu gut; auch dort nicht, wo das sozialistische Gleichheitspostulat wie in China (das historisch übrigens interessanteste Beispiel) noch offiziell gilt.
Die Koppelung von staatsbürgerlichem Status und Militärdienst ist, wie der theoretisch am weitesten ausgreifende Beitrag von Francine D'Amico vorführt, ohnehin ideologisch, weil aus dem kämpfenden Soldat nicht notwendig ein gleichberechtigter Bürger wird. Ob das Militär allerdings von innen heraus, sozusagen durch den weiblichen Gang durch die Institution, demokratisiert werden kann, wie es in manchen Beiträgen gelegentlich aufscheint, sei dahingestellt. Man muss den Fall Lynndie England nicht unbedingt symptomatisch deuten; doch die von den Autorinnen dokumentierten Tatsachen lassen wenig Spielraum für Illusionen.
Ruth Seifert/Christine Eifler/Heinrich-Böll-Stiftung (Hrsg.): Gender und Militär. Internationale Erfahrungen mit Frauen und Männern in den Streitkräften. Ulrike Helmer Verlag, Königstein/Ts. 2004, 312 Seiten, 24,95.
erstellt von Frila - 10.06.2005


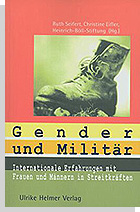


![[EFC Blue Ribbon - Free Speech Online]](http://www.efc.ca/images/efcfreet.gif)
Trackback URL:
https://frilahd.twoday.net/stories/754990/modTrackback