Afghanistan als »zweites Irak«? Der Widerstand gegen US-Besatzungs-truppen und deren afghanische Verbündete wächst
Der Kampf um Afghanistan ist mit neuer Intensität entbrannt. Gerade drei Monate ist es her, da wurde das besetzte Land von Washington noch als Musterbeispiel verkauft für erfolgreiches »Nation-Building« – von US-Gnaden, war gemeint. Inzwischen gibt es fast täglich Meldungen über Gefechte, Entführungen, Exekutionen. Das Wiedererstarken der Taliban und anderer Widerstandsgruppen hätte zu keinem ungünstigeren Zeitpunkt kommen können, gerade einmal zehn Wochen vor der bereits mehrfach verschobenen sogenannten Parlamentswahl, die nun für den 18. September vorgesehen ist. Der erste Abschuß eines US-Hubschraubers mit 17 Soldaten an Bord vor einer Woche und der Verlust einer Kampfgruppe im Osten des Landes nähren die Sorge der Besatzungstruppen, daß sich Afghanistan zu einem zweiten Irak entwickeln könnte.
Am Wochenende setzte die US-Army erstmals wieder seit langem massiv Kampfflugzeuge ein. Diese bombardierten ein Gebiet, in dem sich Taliban-Kämpfer versteckt haben sollen und in dem die vermißten US-Soldaten vermutet werden. Von den gesuchten Männern fehle bislang jede Spur, sagte Militär-sprecher Jerry O’Hara. Es handelt sich um ein kleines Team von Elitesoldaten, das in der Region an der Grenze zu Pakistan im Einsatz war.
Derweil lieferten sich in der Bergwelt im Zentrum des Landes Hunderte der von den Besatzern ausgebildeten afghanischen Soldaten erbitterte Gefechte mit Taliban-Kämpfern. 25 Rebellen und sechs Soldaten seien dabei am Samstag getötet worden, verlautete aus Kabul. Die Truppen griffen ein Lager der Aufständischen in Charchino in der Provinz Urusgan an. Am Samstag suchten die Soldaten nach etwa hundert Rebellen, denen zunächst die Flucht gelungen war. »Es sind noch zahlreiche Taliban dort draußen. Wir werden sie fangen oder töten«, sagte der Gouverneur von Urusgan, Jan Mohammed Chan. Schon in den Tagen zuvor hatten Gefechte in der Region 25 Menschen das Leben gekostet. In der Provinz Paktia wurde ein Bombenanschlag auf einen Autokonvoi verübt. Vier Polizisten wurden getötet, ein Polizeichef und ein weiterer Mann wurden verletzt, wie Gouverneur Gulab Schah Mungal erklärte. Zu dem Konvoi gehörten auch Wagen der Vereinten Nationen.
Zusätzlich zu den Kämpfen steigt auch die Kriminalität. Erst vor wenigen Wochen wurde eine Italienerin in Kabul entführt, um Gefälligkeiten von der Regierung zu erpressen. Der Opiumhandel nimmt zu, und Afghanistan ist auf bestem Wege, ein Drogenstaat zu werden. Und auch der Widerstand großer Teile der Bevölkerung gegen die US-Truppen wächst. Nach Berichten über Koranschändungen in Guantanamo kam es im Mai zu blutigen Auseinandersetzungen mit mehreren Toten.
Tatsächlich wurden nach offiziellen Angaben in den vergangenen Monaten so viele Menschen wie lange nicht getötet: fast 500 mutmaßliche Rebellen, 134 Zivilpersonen, 47 »Sicherheitskräfte« und 45 US-Besatzungssoldaten. Dabei ist völlig offen, über wie viele Kämpfer die Taliban und andere Gruppen verfügen. Durch den wachsenden Widerstand gerät auch der Plan der Besatzer und ihrer Regierung immer stärker unter Druck, im September wählen zu lassen. Die NATO hat angekündigt, mit 3000 zusätzlichen Soldaten die Wahl abzusichern. Präsident Hamid Karsai versetzte die lokalen Polizeikräfte in Alarmbereitschaft, um für Attacken gerüstet zu sein.
Wie es ansonsten um die Vorbereitung der »demokratischen Wahlen« bestellt ist, verdeutlichte am Samstag die nationale Wahlkommission. Sie schloß 200 Bewerber für eine Kandidatur aus. Diese hätten Verbindungen zu bewaffneten Gruppen, verlautete aus Kabul.
Raoul Wilsterer
junge Welt vom 4.7.2005
erstellt von Frila - 05.07.2005
Oberlandesgericht Karlsruhe: Generalbundesanwalt muß nicht gegen US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld wegen Gefangenenmißhand-lung im Irak vorgehen
Das Oberlandesgericht (OLG) Karlsruhe hat es abgelehnt, Generalbundesanwalt Kay Nehm zu Ermittlungen wegen Gefangenenmißhandlungen im Gefängnis Abu Ghraib im Irak zu verpflichten. Das Karlsruher Gericht sei in dieser Sache nicht zuständig, hieß es in einem am Freitag nachmittag veröffentlichten Beschluß des Gerichts.
Nehm hatte sich im Februar geweigert, gegen US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld und andere US-Militärs wegen der Folter von Gefangenen im besetzten Irak zu ermitteln. Zuvor hatte Rumsfeld hatte am 29. November 2004 aufgrund einer von dem Berliner Rechtsanwalt und Vorsitzenden des Republikanischen Anwaltsvereins (RAV), Wolfgang Kaleck, erstatteten Straftanzeige seine Teil-nahme an der NATO-Sicherheitskonferenz abgesagt. Nehms Ablehnung, gegen ihn zu ermitteln, bewog Rumsfeld dann doch zu der Teilnahme an dem Treffen der Kriegsstrategen am 12. und 13. Februar in München.
Kaleck hatte daraufhin am 10. März eine Gegenvorstellung bei der Bundes-anwaltschaft und einen Antrag auf gerichtliche Entscheidung beim Oberlandes-gericht (OLG) Karlsruhe eingereicht, um doch noch eine Anordnung zur Erhebung der öffentlichen Klage gegen Rumsfeld und Co. zu erreichen. In seinem Schreiben an Kay Nehm und das OLG begründete der Rechtsanwalt – wie bereits in seiner Strafanzeige vom vorigen Jahr – sehr ausführlich, warum gegen Rumsfeld, gegen Generäle und ranghohe Offiziere strafrechtliche Schritte einzuleiten seien beziehungsweise, warum die bundesdeutsche Justiz zur Strafverfolgung nach dem deutschen Völkerstrafgesetzbuch verpflichtet sei. So statuiere das deutsche Völkerstrafgesetzbuch in seinem Paragraphen 1 das Weltrechtsprinzip, wonach die deutschen Strafverfolgungsbehörden nach dem Legalitätsprinzip auch dann zur Verfolgung von Straftaten verpflichtet wären, wenn Taten von Ausländern gegen Ausländer im Ausland begangen werden. Eine nach den Tatbeständen des Völkerstrafgesetzbuches begangene Handlung – also Kriegsverbrechen, Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit – müsse demnach keinen Inlandsbezug aufweisen. In einer Stellungnahme vom 4. April entgegnete Generalbundesanwalt Nehm darauf nur lapidar, daß er die Zuständigkeit des OLG Karlsruhe als nicht gegeben ansehe.
Daß die deutsche Strafverfolgungsbehörden die Vorwürfe gegen Rumsfeld und Co. nicht ignorieren können und nach dem Völkerstrafgesetzbuch auch zur Strafverfolgung verpflichtet sind, belegte Kaleck dann am 15. April mit einem – schon in seinem Klageerzwingungsantrag angekündigten – völkerrechtlichen Gutachten, das die Völkerrechtler Prof. Dr. Michael Bothe und Dr. Andreas Fischer-Lescano von der Goethe-Universität Frankfurt/Main erstellt hatten. In ihrem 17seitigen Statement kommen auch sie zu dem Ergebnis, daß nach Völkergewohnheitsrecht die Befugnis eines jeden Staates, also auch Deutschlands, besteht, Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord nach dem auch in Paragraph 1 des am 30. Juni 2002 in Kraft getretenen Völkerstrafgesetzbuches enthaltenen Weltrechtsprinzip strafrechtlich zu verfol-gen. Nach ihrer Ansicht komme es dabei auf den Tatort oder die Staats-angehörigkeit von Täter und Opfer außerdem nicht an.
Bothe und Fischer-Lescano gaben zu verstehen, daß der Grundsatz der Sub-sidiarität zwar eine Zuständigkeit deutscher Gerichte nach dem Weltrechts-prinzip ausschließen könne, aber nur wenn und soweit gesichert ist, daß ein anderer Staat die fraglichen Täter wirklich verfolge. Davon kann bei Rumsfeld und Co. nicht ausgegangen werden – jedenfalls nicht in den USA. Genau das aber behauptete Kay Nehm und zog sich so aus der Verantwortung. Mit der Verneinung seiner Zuständigkeit stützt das Oberlandesgericht Karlsruhe diese Argumentation. (Aktenzeichen: Oberlandesgericht Karlsruhe 1 Ws 41/05)
Dietmar Jochum
junge Welt vom 4.7.2005
erstellt von Frila - 05.07.2005
Das Projekt »1000 Frauen für den Friedensnobelpreis 2005« steht unter dem Patronat der Schweizer UNESCO-Kommission
Eintausend Frauen sollen in diesem Jahr mit dem Friedensnobelpreis ausge-zeichnet werden. Sie stehen stellvertretend für alle Frauen, die gegen Krieg und Ausbeutung kämpfen. Die Namen der Frauen wurden am Mittwoch an 40 Orten weltweit öffentlich gemacht. Das Projekt »1000 Frauen für den Friedens-nobelpreis 2005« steht unter dem Patronat der Schweizer UNESCO-Kommission. Ziel ist es, weltweit auf Friedensarbeit von Frauen aufmerksam zu machen. Ende Januar 2005 hat die Initiative beim Nobelpreiskomitee in Oslo eine Kandida-tinnenliste eingereicht. Das Komitee nahm die Nominierung an. Entschieden wird über die Preisträger aber erst im Herbst.
»Heute wird die Arbeit der 1000 Frauen sichtbar«, erklärte Nationalrätin Ruth-Gaby Vermot-Mangold, Präsidentin der Initiative, am Mittwoch in Bern. Es sei ein Tag der Hoffnung und gleichzeitig ein Meilenstein eines Schweizer Projekts mit weltweiter Ausstrahlung. Die Zahl 1000 sei symbolisch, sagte Ruth-Gaby Vermot-Mangold. Die ausgewählten Frauen solle man stellvertretend sehen. »Alle Nomi-nierten setzen sich täglich und oft unter schwierigsten Bedingungen für Frieden und Gerechtigkeit ein.«
Die meisten der Frauen würden im Kleinen und Versteckten arbeiten, erläuterte die Präsidentin. Einige seien auch Mitglieder von Regierungen oder internatio-nalen Organisationen. »Bedingung für eine Nomination war lediglich, daß ihre Arbeit gewaltlos, nachhaltig und uneigennützig ist und mit legalen Geldern finanziert wird.«
Die Argentinierin Irene Rodriguez zum Beispiel setze sich für Menschenrechte von illegalen Migrantinnen ein. Sie sei selber ein Opfer von Prostitution und Menschenhandel gewesen, bevor sie ohne gültige Papiere in die Schweiz gekommen sei. »Heute ist Irene Rodriguez eine Stimme für diejenigen, die sonst keine haben«, sagte die Zürcher Stadträtin und Vizepräsidentin des Vereins, Monika Stocker.
Der Friedensnobelpreis wird jedes Jahr am 10. Dezember, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel, in Oslo verliehen. Die von dem schwedischen Industriellen und Erfinder Nobel (1833-1896) gestiftete Auszeichnung ist derzeit mit umgerechnet 1,1 Millionen Euro dotiert. Ein aus fünf Mitgliedern bestehender Ausschuß des norwegischen Parlaments wählt den bzw. die Preisträger aus. Neben Einzelpersonen können auch Organisationen, die sich um den Frieden oder die Menschenrechte verdient gemacht haben, den Preis erhalten.
Als erste Frau erhielt die Schriftstellerin und Pazifistin Bertha von Suttner 1905 den Friedensnobelpreis. 1991 wurde die birmanische Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi ausgezeichnet, 2003 die iranische Menschenrechtlerin Shirin Ebadi, im vergangenen Jahr die kenianische Umweltaktivistin und stellvertretende Umweltministerin Wangari Maathai.
Zu den Organisationen, die den Friedensnobelpreis erhielten, zählen das Internationale Rote Kreuz (1917 und 1963), das Kinderhilfswerk UNICEF (1965), amnesty international (1977), Ärzte ohne Grenzen (1999) und die Vereinten Nationen (2001, zusammen mit UN-Generalsekretär Kofi Annan).
.
Nominiert: 15 Frauen aus Deutschland
Von der Initiative sind auch 15 Frauen aus Deutschland nominiert worden. Die Geschäftsführerin von »filia.die frauenstiftung«, Christiane Grupe, teilte am Mittwoch in Hamburg mit, daß sich die vorgeschlagenen Frauen vor allem für Behinderte, Kinder Arme, Prostituierte und Opfer von Menschenhandel einsetzen.
- Schwester Lea Ackermann, Schwester des Ordens von Afrika, Gründerin des Vereins Solwodi (Solidarity with Women in Distress) in Kenia zur Hilfe für Opfer von Menschenhandel und Prostitution;
- Seyran Ates, türkische Rechtsanwältin in Berlin, die gegen Zwangsehen und »Ehrenmorde« vorgeht;
- Judith Theresia Brand, Sozialarbeiterin in Freiburg, gründete 1999 die interethnische Begegnungsstätte Hareja für in Not geratene Frauen und Kinder aus Serbien und dem Kosovo;
- Maria Christine Färber, leitet für Caritas International in Nordalbanien ein Projekt für Frauen und Kinder aus Familien, die in Blutrachefehden verstrickt sind;
- Monika Gerstendörfer, Mitbegründerin und Geschäftsführerin der Lobby für Menschenrechte e.V. und Expertin für Netzwerke gegen sexualisierte Gewalt in Deutschland;
- Barbara Gladysch, gründete 1981 die Initiative »Mütter für den Frieden« und 1997 mehrere Therapiezentren »Little Star Points« für kriegstrauma-tisierte tschetschenische Kinder in Grosny;
- Heide Göttner-Abendroth, Philosophin und Matriarchatsforscherin, grün-dete 1986 die freie »Internationale Akademie Hagia« zur Unterstützung von Frauen, leitete 2003 in Luxemburg und 2005 in den USA die ersten beiden Weltkongresse für Matriarchatsforschung;
- Marianne Grosspietsch, Gründerin der Station »Shanti Sewa Griha« für Leprakranke in Katmandu, die derzeit mehr als 1200 Nepalesen betreut;
- Monika Hauser, Frauenärztin und Geschäftsführerin der Frauenhilfsorga-nisation »medica mondiale«, gründete 1992 in der bosnischen Stadt Zeni-ca ein Therapiezentrum für vergewaltigte und kriegstraumatisierte Frauen;
- Karla-Maria Schälike, Heilpädagogin, gründete 1989 das Kinderzentrum »Nadjeschda« für behinderte Kinder in Kirgisien und 1992 einen Förder-verein für das Betreuungsprojekt »Ümüt-Nadjeschda«;
- Cathrin Schauer, seit zehn Jahren Streetworkerin und Sozialarbeiterin im Rotlichtmilieu an der deutsch-tschechischen Grenze und Gründerin der Organisation Karo e.V.;
- Bosiljka Schedlich, gründete 1991 in Berlin das »Südost Europa Kulturzen-trum«, das seither 30000 Kriegsflüchtlinge aus Jugoslawien betreute;
- Karla Schefter, ehemalige OP-Schwester bei »Ärzte ohne Grenzen«, leitet seit 15 Jahren das von ihr gegründete Chak-e-Wardak-Hospital in Afgha-nistan;
- Sabriye Tenberken, blinde Pädagogin, gründete 1998 die erste Schule für blinde Kinder in Tibet, die heute ein Rehabilitations- und Ausbildungs-zentrum ist;
- Ruth Weiss, jüdische Journalistin und Buchautorin, die sich aktiv an Pro-jekten zur Überwindung des Rassismus engagiert, darunter besonders im südlichen Afrika.
Ulla Jelpke
junge Welt vom 1.7.2005
erstellt von Frila - 05.07.2005
Öffentliches Hearing linker EU-Parlamentarier in Strasbourg. Alterna-tives Sicherheitssystem gefordert
Mit »Waffenexporten in der Europäischen Union« beschäftigten sich europäische Linke am Mittwoch in Strasbourg. Die Fakten stellte EU-Abgeordneter Tobias Pflüger vor. Demnach tätigten Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Italien und Schweden als die wichtigsten Waffenexporteure in der EU in den Jahren 1994–2001 ein Drittel aller weltweit abgeschlossenen Rüstungsgeschäfte. Mit der EU-Erweiterung sei inzwischen auch der Anteil am globalen Rüstungsexport-markt gestiegen. Mittlerweile exportiere die EU mehr Waffen als die USA.
Während des öffentlichen Hearings, zu dem die Linksfraktion (GUE/NGL) im Europäischen Parlament eingeladen hatte, verwies Lühr Henken vom Kasseler Friedensratschlag auf die besondere deutsche Rolle beim Rüstungsexport. Zwar hätte dieser schon unter der Kohl-Regierung einen kräftigen Anschub bekommen, aber erst mit SPD und Grünen seien »alle Hemmungen« gefallen, besonders beim Export von Kleinwaffen, der sich seither fast verdoppelt habe. Einen Beitrag dazu leistet das deutsche Haushaltsgesetz. Demnach ist dem Staat »die Verschrottung von ausgemusterten Waffen« verboten. Zugleich sei vorgeschrieben, daß Waffen ebenso wie zivile Güter bei Ausmusterung vom Bund zum Verkauf angeboten werden müssen. Darauf wies Otfried Nassauer vom Berliner Informationszentrum für Transatlantische Sicherheit (BITS) hin. Eine Revision des Haushaltsgesetzes wegen der »tödlichen Langzeitwirkung« von Waffenexporten sei also dringend geboten, schlußfolgerte Nassauer.
Nach Einschätzung des ehemaligen schwedischen EP-Abgeordneten Prof. Herman Schmid sind Waffenexporte in der EU heute weitgehend kommerzialisiert und kein Bestandteil der »traditionellen Sicherheitspolitik« mehr. Ausnahme sei Frankreich, weil dort die Rüstungsindustrie noch weitgehend unter Kontrolle des Staates steht. In allen übrigen Ländern würde die Förderung von Waffenexporten als ganz normale Industrieförderung gesehen. Der spanische Abgeordnete Willy Meyer fand, daß die Europäer mit den USA kaum noch durch »gemeinsame Werte« verbunden seien. Deswegen müßten die Europäer schleunigst ein »alternatives, entmilitarisiertes Sicherheitssystem« entwickeln und Schluß machen mit der »grenzenlose Aufrüstung«.
Das Hearing beschäftigte sich zudem insbesondere mit der Rolle der neuen europäischen Rüstungsagentur und der Formulierung eines gemeinsamen EU-Verhaltenskodexes für die Zukunft der EU-Waffenexporte. Christopher Steinmetz (BITS) ging dabei davon aus, daß der strukturelle Einfluß der Agentur auf die EU-Rüstungsindustrie »stark und nachhaltig« sein wird. Derweil verwies Pflüger darauf, daß die EU-Rüstungsagentur derzeit in einem »halb-rechtsfreien Raum« operiert. Der Chef der Agentur, Nick Witney, sei bisher allen Fragen nach der Rechtsgrundlage der Agentur ausgewichen.
Rainer Rupp
junge Welt vom 1.7.2005
erstellt von Frila - 05.07.2005
Heute vor zehn Jahren gab Bundestag erstmals grünes Licht für einen Kampfeinsatz der Bundeswehr – die Beteiligung am NATO-Bombarde-ment gegen die bosnischen Serben
Die Archäologen einer künftigen Zivilisation werden einmal im Schutt unserer Städte wühlen, in den Katakomben unter der Reichshauptstadt, im Kanzler-bunker, und sie werden über den Fragen brüten, die sich unsere Historiker zu Karthago stellten: Warum ist dieses Reich verschwunden? Warum sind seine Bürger, als ihr Land noch bewohnbar nach dem zweiten war, in den dritten Krieg marschiert?
Die eine Denkschule des postkarthagischen Zeitalters wird auf den Untergang der Bonner Republik im Zuge der Wiedervereinigung verweisen. Ab diesem Zeitpunkt sei die genügsame Außenpolitik einem neuen imperialen Machtanspruch gewichen, wie sich etwa an den »Verteidigungspolitischen Richtlinien« aus dem Jahre 38 v. n. W. (vor dem nuklearen Winter – in der damaligen Zeitrechnung 1992 n. Chr.) ablesen lasse. Andere werden dagegenhalten, daß doch zu diesem Zeitpunkt die republikanische Machtbalance noch intakt gewesen sei – den Legionären auf der Hardthöhe habe immer noch ein kräftiger sozial-ökologischer Widerpart Paroli geboten. Einer von dessen Sprechern, ein gewisser Joseph (oder Joschka – die Quellen differieren) Fischer sei sogar 32 v. n.W. deutscher Außen-minister und Vizekanzler geworden.
Ein sensationeller Fund halbgeschmolzener Computerfestplatten in der atomar verseuchten Sperrzone rund um den Bendlerblock barg des Rätsels Lösung: Parlamentsprotokolle, Zeitungsausschnitte, Fernsehmitschnitte aus dem Jahr 35 v.n.W. – in der damaligen Zeitrechnung 1995 n. Chr. In diesem Jahr brach der Widerstand der moderaten Kräfte gegen den Bellizismus zusammen, oder genauer gesagt: Die vormaligen Opponenten wechselten die Seite. Es war der letzte Sommer der alten Republik.
Tag X: 30. Juni 1995
Bis zum Juni 1995 galt in der deutschen Politik das vom damaligen Bundes-kanzler Helmut Kohl verkündete Axiom: Niemals Bundeswehrsoldaten in Gebie-ten einsetzen, die einst die Wehrmacht okkupiert hatte. Vorstößen aus der Union und aus dem konservativen Medienkartell, diesen Grundsatz aufzugeben und deutsche Soldaten zum dritten Mal in jenem Jahrhundert gegen Serbien in Marsch zu setzen, standen ebenso starke Widerstände der Opposition von SPD und Grünen entgegen. So versuchte etwa die SPD, der Beteiligung der Luftwaffe an den NATO-Überwachungsflügen in Bosnien durch Klagen vor dem Bundesver-fassungsgericht einen Riegel vorzuschieben, und die Bündnisgrünen unterstri-chen ihr kategorisches Nein zu allen Out-of-area-Einsätzen – auch Blauhelmmis-sionen! – bisweilen sogar durch außerparlamentarischen Protest.
Der 30. Juni 1995 markiert das Ende der Kohl-Maxime, der Bundestag gab grünes Licht für den ersten Kriegseinsatz der Bundeswehr. Zur Unterstützung einer britisch-französischen Bosnien-Eingreiftruppe wurden die Luftwaffe und Sanitäts-züge bereitgestellt. Jörg Schönbohm, Staatssekretär im Bundesverteidigungs-ministerium, betonte, »daß es diesmal nicht um eine humanitäre Operation wie in Somalia oder Kambodscha« gehe. »Sondern jetzt werden deutsche Soldaten außerhalb des NATO-Verteidigungsgebietes eingesetzt, mit der Möglichkeit, kämpfen zu müssen.«
Vier grüne Abgeordnete und 45 Sozialdemokraten stimmten am 30. Juni mit der Regierung. Oskar Lafontaine kritisierte die Abweichler: »Einige Helden in der SPD ... plapperten ... mit dem Champagnerglas in der Hand« Positionen der Union nach. Man dürfe die Umdefinierung der NATO von einem Verteidigungsbündnis zu einer Interventionsallianz nicht zulassen. Joseph Fischer bezeichnete den Entscheid als »historische Zäsur« und als »Debakel, für das noch viele politisch und manche vielleicht auch mit ihrem Leben bezahlen müssen«. SPD-Bundesgeschäftsführer Günter Verheugen wies in der Debatte auf den Umstand hin, daß die Bundesregierung keineswegs von ihren Bündnispartnern zur Bereitstellung von Truppen oder Flugzeugen aufgefordert werden sei, was ihm von Wolfgang Schäuble den Zwischenruf »geborener Verräter« einbrachte. Verheugen kritisierte, daß »die Koalition uns in eine Prä-Vietnam-Situation gebracht [hat], und wir rutschen immer tiefer in die Grauzone ... und befinden uns irgendwann, ohne es recht bemerkt zu haben, im Krieg«.
Aber als zwei Monate später die Kohl-Regierung unter Berufung auf den Bundes-tagsbeschluß vom 30. Juni grünes Licht zum Angriff gab, war von der Opposition nichts mehr zu hören. Am 30. August 1995 begannen NATO-Kampfflugzeuge einen vierzehntägigen Bombenkrieg gegen serbische Stellungen in Bosnien. Tornados der Bundesluftwaffe flogen fleißig mit. Dies, und nicht der Angriff auf Jugoslawien 1999, war der erste Kriegseinsatz des westlichen Bündnisses und der Bundeswehr – aber kaum jemand hat es gemerkt, denn die Öffentlichkeit war durch die Zustimmung von SPD und Grünen eingelullt. Den Angriffen, bei denen auch Munition aus abgereichertem Uran eingesetzt wurde, fielen mehrere hundert Menschen zum Opfer.
Rummel um Srebrenica
Das Einknicken der parlamentarischen Kriegsgegner zwischen 30. Juni und 30. August wurde durch ein einziges Ereignis ausgelöst: die Eroberung der ostbosnischen UN-Schutzzone Srebrenica durch die Serben am 11. Juli. »Seit Srebrenica habe ich meine Position verändert«, sagte Fischer im Rückblick. Deswegen wird der Medienrummel rund um den 11. Juli gerade an diesem zehnten Jahrestag ebenso groß sein wie das Schweigen am heutigen 30. Juni. Sonst könnte nämlich noch einer drauf kommen, daß der deutsche Beschluß zum Kriegseintritt vor der Tragödie von Srebrenica gefaßt wurde ...
Jürgen Elsässer
.
Chronologie: Bundeswehr auf dem Balkan
Juni 1995: Die Bundeswehr unterstützt mit Transport- und Aufklärungsflug-zeugen die UN-Truppen im Bosnien-Herzegowina. Deutsche Soldaten sind unter anderem an der vierzehntägigen Bombardierung serbischer Stellungen beteiligt.
Ab 1996: Nach dem Abkommen von Dayton im November 1995 werden bewaff-nete Bundeswehreinheiten in Bosnien-Herzegowina stationiert.
März 1997: Im Rahmen der Operation Libelle dringen Hubschrauber der Bundes-wehr in Albanien ein, wo gerade bürgerkriegsähnliche Auseinandersetzungen stattfinden.
März bis Juni 1999: Die Bundeswehr beteiligt sich am NATO-Krieg gegen Jugoslawien. Tornado-Kampfflugzeuge bereiten mit ihren Aufklärungsflügen Bombardements vor.
Seit Juni 1999: Bundeswehreinheiten gehören zur Besatzung der serbischen Provinz Kosovo und kontrollieren um Prizren einen eigenen Sektor.
August 2001: Deutsche Soldaten beteiligen sich an einem NATO-Einsatz in Maze-donien zur Entwaffnung von Bürgerkriegsbanden, nachdem die mazedonische Regierung durch starken Druck ihre »Einwilligung« dazu erklärt hat.
17. November 2004: Der Bundestag macht den Weg frei für eine Beteiligung der Bundeswehr an der EU-Operation »Althea«. Sie löst die NATO in Bosnien-Herzego-wina ab.
(jW)
junge Welt vom 30.6.2005
erstellt von Frila - 05.07.2005
Istanbul: Internationales Irak-Tribunal hielt über Washingtons Füh-rung symbolisch Gericht
Während US-Präsident George W. Bush am Wochenende seine Landsleute auf weitere »harte Kämpfe« im Irak einschwor, saß in der Türkei ein internationales Tribunal über Washingtons mächtigen Feldherrn zu Gericht. Bekannte Schrift-steller, ehemalige UN-Diplomaten sowie Menschenrechts- und Friedensaktivisten aus aller Welt berieten in Istanbul von Freitag bis Sonntag abend über den Irak-Krieg und klagten die USA dabei wegen Kriegsverbrechen und Verstößen gegen das Völkerrecht symbolisch an. »Der Krieg im Irak ist einer der feigsten der Geschichte«, sagte die indische Schriftstellerin Arundhati Roy in ihrer Rede in Istanbul. »Internationale Institutionen wurden benutzt, um ein Land zur Abrüstung zu zwingen. Und dann standen sie dabei, als das Land mit einer nie dagewesenen Waffengewalt angegriffen wurde.«
Kriegsopfer aus dem Irak schilderten der Jury die Situation in ihrem Land unter der Besatzung. Dort sei es mittlerweile »schlimmer als unter Saddam«, so eine Irakerin. Emma Kammas vom unabhängigen Zentrum »Occupation Watch« in Bagdad warf den US-Truppen vor, selbst vor der Zerstörung von Krankenhäusern, etwa in Falludscha, nicht haltzumachen. »Scharfschützen jagten die Menschen auf den Straßen«, so Kammas weiter. Am heutigen Montag will die international besetzte Jury der Öffentlichkeit ihr Urteil über Bushs Feldzug präsentieren und begründen.
Der in Istanbul angeklagte US-Präsident Bush warb unterdessen mit einer landes-weit ausgestrahlten Radioansprache am Samstag bei seinen Landsleuten um Rückhalt für die Irak-Besetzung. Die »Mission« im Irak »sei schwierig«, räumte er ein. In den kommenden Wochen werde es weitere »harte Kämpfe« geben.
Bei verschiedenen Angriffen auf die Besatzungstruppen und einheimische Kollabo-rateure wurden am Wochenende fast 70 Menschen getötet. Die folgenschwersten Anschläge gab es auf Stützpunkte bei Mosul und in Samarra.
* Weitere Informationen zum Irak-Tribunal: www.worldtribunal.org
Rüdiger Göbel
junge Welt vom 27.6.2005
erstellt von Frila - 05.07.2005
EU-Parlamentarier sprachen sich für einheitlichen Markt für militäri-sche Güter aus. Selbst Vertretern der Waffenschmieden ging das zu weit
Die Beschaffung von Verteidigungsgütern auf dem Binnenmarkt« lautete – poli-tisch korrekt – der Titel der öffentliche Anhörung am Donnerstag im Europäi-schen Parlament (EP) in Brüssel. Teilgenommen hatte eine Reihe hochkarätiger Persönlichkeiten aus der europäischen Rüstungsindustrie. Mit etwas Mühe waren im Bildhintergrund des Posters, das die Anhörung ankündigte, Schnürstiefel zu erkennen. Diese sollten wohl die Harmlosigkeit der »Verteidigungsgüter« demonstrieren, über die der Ausschuß für Binnenmarkt und Verbraucherschutz und der Unterausschuß für Sicherheit und Verteidigung diskutieren wollten. Nur die im Saal ausgelegten Hochglanzbroschüren ließen erahnen, worum es tatsäch-lich ging. Sie enthielten Fotos neuester Panzer, Kampfhubschrauber und Raketen. Mit diesen, so der Begleittext der Rüstungsabteilung (DGA) des französischen Ver-teidigungsministeriums, solle »die zukünftige europäische strategische Autono-mie« geschaffen werden.
Lukrative Geschäfte
Begeistert sprach Arturo Morino, Vertreter der neuen EU-Rüstungsagentur (EDA), denn auch davon, daß es darum gehe, »militärische Kapazitäten zu schaffen«, um weiter »festzustellen, wo die Lücken sind«. Diese sollten dann »mit neuen Aufträgen« gefüllt werden. Auf die Frage des einzigen Vertreters der europäi-schen Linksfraktion im Unterausschuß für Sicherheit und Verteidigung, Tobias Pflüger, warum das Budget der EDA außerhalb jeglicher parlamentarischer Kontrolle steht, gab es nur eine ausweichende Antwort.
Die Vertreterin der Grünen-Fraktion im Sicherheitsausschuß, Angelika Beer, forciert die EP-Initiative. Als eine von zwei Berichterstattern forderte sie den einheitlichen Markt für die »Beschaffung von Waffen, Munition und Kriegs-material« und deshalb die »Abschaffung der rüstungspolitischen Besonderheiten« von Artikel 296 des EG-Vertrags. Dieser Artikel gewährt den 25 EU-Mitglieds-ländern im Fall des Vorliegens von nationalen »essentiellen Sicherheits-interessen« bei der Beschaffung von Rüstungsmaterial ein Schlupfloch. Anders als bei zivilen Gütern, bei denen eine EU-weite Ausschreibung vorgeschrieben ist, kann jede Regierung bei Rüstungsgütern dort kaufen, wo sie will. Daher wurde Artikel 296 für die mangelnde Transparenz und den ausbleibenden Wettbewerb auf dem europäischen Rüstungsmarkt ebenso verantwortlich gemacht wie für doppelte industrielle Rüstungskapazitäten und die daraus resultierenden erhöhten Preisen für Waffensysteme.
Durch die vielfache Zerstückelung des europäischen Rüstungsmarktes, der vom französischen Rüstungsdirektor Francois Lureau auf 44 Milliarden Euro plus zwölf Milliarden Euro für militärische Forschung geschätzt wird, habe die europäische Rüstungsindustrie weder die »Vorteile von Großserien« noch den Hauch einer Chance, mit den USA auf diesem Gebiet zu konkurrieren. »Wir (Europäer) müssen unser Territorium auf dem Weltrüstungsmarkt abstecken« forderte denn auch der Vertreter der britischen Rüstungsindustrie, Jeremy Miles.
Gewerkschafter im Boot
Deshalb rief Burghard Schmidt vom EU-finanzierten »Institut für Sicherheits-studien« in Paris ganz militärisch die Parlamentarier »zum Sturmangriff« auf Artikel 296 auf. Dabei wurde er von gewerkschaftlicher Seite unterstützt. Ohne Sinn und Zweck der massiven EU-Aufrüstung zu hinterfragen, forderte Hardy Koch vom Europäischen Metallgewerkschaftsbund in dem zu erwartenden Umstrukturierungsprozeß der Rüstungsindustrie lediglich die soziale Absicherung für die dort Beschäftigten.
Die allseits geforderte Abschaffung von Artikel 296 ging den anwesenden Vertretern der Rüstungsindustrie letztlich aber doch zu weit. Denn dies würde den europäischen Rüstungsmarkt, auch für sogenannte sensible Waffensysteme, notgedrungen US-amerikanischen Produkten öffnen, warnte z. B. Timm Meyer von der Industrievereinigung UNICE. Ohnehin zeigte er sich bezüglich der EP-Initiative reichlich skeptisch. Seit 35 Jahren sei er nun bereits in dem Geschäft und habe schon viele derartige Initiativen verfolgt. Sie seien alle gescheitert. Auf diesem Gebiet werde »zwar gern und oft europäisch geredet, aber national gehandelt«, so der Rüstungslobbyist.
Rainer Rupp
junge Welt vom 25.6.2005
erstellt von Frila - 05.07.2005

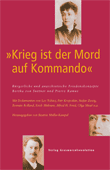
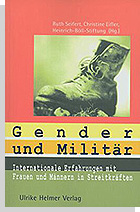


![[EFC Blue Ribbon - Free Speech Online]](http://www.efc.ca/images/efcfreet.gif)