Der Melzer Verlag stellte in Berlin einen Sammelband vor, der dem Kriegsgegner Albert Einstein gewidmet ist
Präsentiert werden sollte ein Buch, vorgestellt wurde ein Programm – der Name Einstein ist ein Synonym für Unversöhnlichkeit mit Militarismus und Kriegszügen, speziell deutschen. Reiner Braun hat zusammen mit David Krieger den Smmelband »Albert Einstein – Frieden heute. Visionen und Ideen« herausgegeben, mit Beiträgen von Politikern und Wissenschaftlern, darunter zahlreichen Nobelpreisträgern. Braun schreibt einleitend: »Sein Leben lang blieb Einstein seinen Prinzipien treu: als Jugendlicher, der alles tat, den verhaßten Militärdienst zu verweigern, als – gerade wenige Monate an der Preußischen Akademie der Wissenschaften tätiger – junger Mann, der durch die Unterzeichnung des ›Aufrufes an die Europäer‹ den Ersten Weltkrieg verurteilte und besonders den preußischen Militarismus angriff (...) Einstein engagierte sich weltweit für die Kriegsdienstverweigerer, war ein unermüdlicher Warner und stritt für atomare Abrüstung.« Braun zitiert aus dem im Band abgedruckten »Russell-Einstein-Manifest« von 1955: »Im Hinblick darauf, daß in einem zukünftigen Krieg ohne jeden Zweifel Kernwaffen angewandt würden und daß diese Waffen den Fortbestand der Menschheit gefährden, ersuchen wir nachdrücklich die Regierungen der Welt, zu erkennen und öffentlich zu bekennen, daß sie ihre Ziele nicht durch einen Weltkrieg erreichen können, und wir ersuchen sie dringlichst darum, friedliche Mittel der Lösung für alle zwischen ihnen bestehenden Konflikte ausfindig zu machen.«
Die Sätze sind hochaktuell: Die nukleare Planungsgruppe der NATO beschloß vor wenigen Tagen, weiterhin Nuklearwaffen in Deutschland bereitzuhalten. Bei der Buchvorstellung am Mittwoch im Berliner Kronprizessinnen-palais, dem Ort der Einstein-Ausstellung, wies Willy Wimmer, ehemals Staatssekretär im Bundesverteidigungs-ministerium und CDU-Bundestagsabgeordneter, auf den gefährlichen Hintergrund solcher Entscheidungen hin. Im Kalten Krieg sei ein System von »Diplomatie und militärischem Rückgrat« erarbeitet worden, das vor einer militärischen Auseinandersetzung zwischen Ost und West bewahrt habe. Der Entspannungsansatz habe zu Beginn der »unglückseligen 90er Jahre« noch existiert, China sei Mitte des Jahrzehnts bereit gewesen, auf Abrüstung und ein allgemeines Sicherheitssystem einzugehen. Der Jugoslawien-Krieg habe aber eine neue Situation geschaffen: »Wir kriegen eine neue Ordnung ausgekegelt.« Systematisch sei das Scheitern des vorhandenen friedenspolitischen Ansatzes herbeigeführt worden. Wimmer konstatierte: »Wir brauchen Mut, um zu Einstein zu stehen.«
In einem auf der Veranstaltung verlesenen Text von Verleger Abraham Melzer, der wegen Krankheit nicht teilnehmen konnte, hob dieser hervor, daß Einstein auch zum Nahostkonflikt eine Position vertreten habe, die erst wieder erreicht werden müsse. Einstein habe »lange vor Gründung des Staates Israel und vor dem offenen Ausbruch von Feindseligkeiten zwischen Juden und Arabern« betont, »friedliche Zusammenarbeit zwischen beiden Völkern sei die Voraussetzung einer gesunden Entwicklung des jüdischen Heims in Palästina«.
Engagement von Wissenschaftlern und Wissenschaft für Frieden, Abschaffung der Atomwaffen und Lösung des Palästinakonflikts sind nach den Worten des Herausgebers entscheidende Aspekte der Beiträge des Bandes – eine höchst notwendige Erinnerung an politische Vernunft.
Arnold Schölzel
* Reiner Braun/David Krieger: Albert Einstein – Frieden heute. Visionen und Ideen. Melzer Verlag, Neu Isenburg 2005, 333 Seiten, 19,95 Euro
junge Welt vom 17.6.2005
siehe auch:
Verlagstext und Inhaltsverzeichnis
erstellt von Frila - 18.06.2005
US-Magazin veröffentlichte geheimes Folterprotokoll aus Gefangenen-lager Guantánamo. Pentagon verteidigt »bewährte Befragungsansätze«
Der Senat in Washington muß sich am morgigen Mittwoch mit einem neuen Fall von Folter im US-Militärgefangenenlager Guantánamo befassen. Hintergrund ist ein Bericht in der jüngsten Ausgabe des US-Magazins Time, in dem die Gefangenenmißhandlung als alltägliche Lagerpraxis angeprangert wird. Das Blatt berichtete am Sonntag unter Berufung auf das streng geheime Logbuch über das »Verhör« des Gefangenen Nr. 063. US-Soldaten hatten demnach den saudiarabischen Gefangenen Mohammed Al Kahtani über Monate hinweg gedemütigt und gequält, bis er schließlich gestanden habe, der Terror-organisation Al Qaida anzugehören. Das Pentagon dementierte keinen der Vorwürfe, sondern sprach von »bewährten und überwachten Befragungs-ansätzen«. Zahlreiche US-Senatoren reagierten unterdessen entsetzt über den jüngsten Folterreport.
In dem 84 Seiten umfassenden Geheimprotokoll sind die verschiedenen »Verhörmethoden« minutiös fesgehalten. US-Soldaten hatten den Mann unter anderem nackt ausgezogen, ihm Pornobilder um den Hals gehängt und ihm befohlen, wie ein Hund zu bellen. Einmal hätten die »Verhörexperten« den Moslem auf den Boden gelegt, und eine Soldatin habe sich über ihn gekniet. Als Kahtani versucht habe, die Frau von sich wegzustoßen, hätten die Militärs ihn festgehalten. Als er aus Protest gegen die Mißhandlungen in Hungerstreik trat, wurden ihm durch eine Kanüle im Arm große Mengen Flüssigkeit eingeflößt; anschließend durfte er nicht auf die Toilette gehen, so daß er in die Hose urinieren mußte.
Die täglichen Vernehmungen Kahtanis begannen den Angaben zufolge bereits um vier Uhr morgens und hörten erst um Mitternacht auf. In den Verhörpausen sei er mittels lauter Popmusik am Schlafen gehindert worden. Die Tortur dauerte von November 2002 bis Januar 2003.
Laut Time hat US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld in jener Zeit persönlich 16 zusätzliche Verhörtechniken für bestimmte Gefangene wie Kahtani bewilligt. Dazu gehörten das lange Stehen in schmerzhaften, sogenannten Streßpositionen, bis zu 30 Tagen komplette Isolation sowie sexuelle Erniedrigungen.
Rainer Rupp
junge Welt vom 14.6.2005
erstellt von Frila - 18.06.2005
Geheimdokument enthüllt Londons Bemühungen, den Krieg als rechtmäßig darzustellen
Bereits im Juli 2002 informierte Britanniens Premier Tony Blair die Minister in seinem Kabinett darüber, daß er sich »dazu verpflichtet« hatte, am Irak-Krieg teilzunehmen. Deshalb hätten seine Minister »keine andere Wahl als einen Weg zu finden, um ihn (den Krieg) legal zu machen«. Das berichtete am Sonntag die renommierte britische Sunday Times. Der Zeitung sei ein Regierungsdokument über das Treffen Blairs mit seinen Kabinettsministern am 23. Juli 2002 zugespielt worden. Dieses beweist, daß sich die britische Regierung des beabsichtigten Kriegsverbrechens voll bewußt war: Unterstrichen wird darin, daß auf Grundlage des Völkerrechts ein Krieg zur Herbeiführung eines Regimewechsels illegal ist. Deshalb sei es »notwendig, die Bedingungen zu schaffen«, um ihn legal zu machen.
Eine diesbezügliche Argumentation müsse selbst dann entwickelt werden, wenn sich die Minister gegen eine direkte britische Beteiligung am Krieg aussprechen würden. Schließlich würde das US-amerikanische Militär für den Angriff auf Irak britische Basen benutzen und damit Großbritannien automatisch zum Komplizen jedweder illegalen US-Operation machen. Deshalb sei die »Legalität des Krieges auf jeden Fall von großer Bedeutung, egal für welche Option sich die Minister in bezug auf eine britische Beteiligung entscheiden«.
Als Möglichkeit zur Rechtfertigung einer Invasion wurde vorgeschlagen, Saddam Hussein in eine Position zu drängen, in der er ein Ultimatum der Vereinten Nationen zur Zusammenarbeit mit den Waffeninspektoren ablehnt. »Es könnte gelingen, ein Ultimatum so zu stellen, daß Saddam zurückweisen würde«, heißt es in dem Dokument. Doch wenn er tatsächlich das Ultimatum akzeptierte, würde es »höchst unwahrscheinlich« werden, die legale Rechtfertigung für den Krieg zu bekommen.
Das Dokument aus dem britischen Kabinett belegt unzweifelhaft, daß sich die beiden Kriegsherren in Washington und London nur deshalb an die Vereinten Nationen gewandt haben, um diese zwecks Legalisierung ihres Krieg zu instrumentalisieren – und nicht etwa, »um den Krieg zu verhindern«, wie beide behaupteten.
Rainer Rupp
junge Welt vom 13.6.2005
erstellt von Frila - 18.06.2005
Sternenkriegsrenaissance in den USA
und EU-Beteiligung an der Militarisierung des Weltraums
Den Begriff »Star Wars« – Krieg der Sterne – hörte ich zum ersten Mal 1976 in Los Angeles. Dort tagte im Convention Center von Anaheim der Kongreß der Internationalen Astronautischen Föderation, auf dem Kosmosforscher und Raketentechniker von fünf Kontinenten über die friedliche Erforschung und Nutzung des Weltraums berieten. Kurz zuvor war beim Verlag Ballantine Books in New York der Science-Fiction-Roman »Star Wars« von George Lucas erschienen und machte als Bestseller Furore. Der danach vom Autor gedrehte gleichnamige Film hatte am 1. August 1977 in Hollywoods Uraufführungskino »Chinese Theater« Premiere. Bis 1982 folgten zwei weitere Streifen der Trilogie über Schlachten im Weltraum, die einschließlich der Reklameverwertung fünf Milliarden Dollar einspielte – mehr als die damaligen Kassenschlager »Der weiße Hai« und »Der Pate« zusammen.
»Reagan-Schirm« mit Löchern
Dem »Großen Kommunikator«, wie Journalisten US-Präsident Ronald Reagan titulierten, kam das Leinwandspektakel gerade recht. Er nutzte die durch die Hollywood-Produktion erzeugte Massenhysterie fur die Popularisierung eines kosmischen Hochrüstungsprogramms.
Am 23. März 1983 forderte er in seiner berüchtigten »Star-Wars-Rede« ein mehrfach gestaffeltes weltraumgestütztes Raketenabwehrsystem, das später die offizielle Bezeichnung SDI (Strategic Defense Initiative – Strategische Vertei-digungsinitiative) erhielt.
Der 40. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika versprach seinen Landsleuten einen absolut sicheren Schutzschild gegen feindliche interkon-tinentale ballistische Raketen mit Nuklearsprengköpfen. Trotz Verschwendung von mehr als 130 Milliarden Dollar ließ sich dieser »Reagan-Schirm« jedoch bis heute nicht verwirklichen – er weist einfach viel zu viele große Löcher auf. Sinn und Zweck der illusorischen Ambition bestand und besteht darin, die USA zu befähigen‚ einen ungestraften atomaren Erstschlag gegen jeden beliebigen Feind zu führen. Wer jeweils der »Böse« ist, bestimmt natürlich der »Gute«, also Washington.
In Europa blieb es damals der »Eisernen Lady«, Margaret Thatcher, vorbehalten, am 6. Dezember 1985 für Großbritannien als erstem Land ein SDI-Abkommen mit den USA abzuschließen. Kurz darauf folgte die Regierung Helmut Kohl am 27. März 1986 mit gleich zwei Geheimabkommen: Das »Memorandum of Understanding« vereinbarte die Beteiligung von Firmen der BRD am SDI-Programm und das »Joint Understanding of Principles« legte die Grundsätze für den technologischen Austausch zwischen beiden Ländern fest. Einem westdeutschen Boulevardblatt, dem Kölner Express, gelang investigativer Journalismus. Unter der Schlagzeile »Der geheime SDI-Vertrag« veröffentlichte die Zeitung am 18. April 1986 den vollen Wortlaut der beiden Top-secret-Dokumente. Andere Publikationen wie die Frankfurter Rundschau und Der Spiegel – das, laut Eigenlob, »Sturmgeschütz der Demokratie« – hinkten hinterher, während die Verfassungsschützer sich auf die Suche nach der undichten Stelle im Staatsapparat machten.
Hollywood und Pentagon
Der Übergang vom 20. zum 21. Jahrhundert ist gekennzeichnet durch eine Renaissance des Krieges der Sterne in Hollywood und Washington. 1999 hatte »Star Wars – Episode 1: Die dunkle Bedrohung« Premiere. Ein Jahr später folgte der »Angriff der Klonkrieger«, und im Mai 2005 lief der dritte und letzte Streifen der zweiten Staffel, »Die Rache der Sith« weltweit in den Kinos an. Der virtuose Mix aus banaler Spielhandlung und raffinierter Tricktechnik eskalierte weiter. Mit erwarteten Gesamteinnahmen von zehn Milliarden Dollar wird alles bisherige, einschließlich des Welterfolgs »Titanic«, in den Schatten gestellt.
Das Timing zwischen den Filmemachern und den »Star Warri-ors« (Sternenkrieger), wie sich die Kriegsplaner selbst nennen, ist wiederum perfekt – ob nun bewußt oder unbewußt. Zeitgleich mit der ersten Episode von »Star Wars« erließ das Pentagon die »Directive 3100.10 Space Policy« zum Aufbau einer operativen Weltraumstreitmacht der USA. 2001 folgte der Rumsfeld-Report über »Gewaltanwendung im, aus und durch den Weltraum« und ein »War Game« (Kriegsspiel), das bisher größte Manöver der kosmischen Kriegsführung. Schließlich ordnete am 12. Dezember 2002 der 43. Präsident der USA, George W. Bush, der sich als »Enkel von Reagan« versteht, den Aufbau eines vielfach gestaffelten und zeitweilig weltraumgestützten Raketenabwehrsystems an, dessen Netz Nordamerika, Westeuropa, Japan und Australien umspannt. 53 Milliarden Dollar werden allein in den ersten fünf Jahren benötigt.
Trotz des Etikettenschwindels – NMD (National Missile Defense – Nationale Raketenabwehr) statt SDI – unterscheidet sich der neue Schutzschild der »Bush-Krieger« nur unwesentlich vom alten »Reagan-Schirm«. So sollen »Global Strike« (Globaler Schlag) genannte Präzisionswaffen innerhalb von 45 Minuten jeden beliebigen Punkt der Erde treffen. »Reds from God« (Knarren Gottes) wiederum heißen kosmische Geschosse aus Titan, Uran und Wolfram, die ihre Ziele wie Meteoriten durchschlagen. Die Süddeutsche Zeitung vom 3. September 2004 urteilte über die neuen Rüstungspläne ironisch: »Bisher können die USA nur eine feindliche Rakete im Flug abfangen, die sich an bestimmte Bedingungen hält. Sie muß langsamer als üblich fliegen, ihr Herkunftsort muß bekannt sein, sie muß ein künstlich verstärktes Radarsignal abstrahlen, und sie muß bei hellem Tageslicht heranrauschen.«
Söhne des Sternenkrieges
Zu Beginn des neuen Millenniums waren es keine rechten Regierungen, die in Europa als erste der neuen kosmischen Hochrüstung zustimmten. Vielmehr befürwortete der sozialdemokratische Bundeskanzler Gerhard Schröder schon 2001 eine Beteiligung der BRD an der umstrittenen Raketenabwehr NMD. Der »Genosse der Bosse« stellte einen »erheblichen Push« für die deutsche Wirtschaft in Aussicht und warnte: »Wer nicht mitmacht wird zweitklassig!« Damit argumentierte er wie sein geschmähter Vorgänger Kohl. Professor Richard Garwin, Forschungsdirektor von IBM und Rüstungsberater des Weißen Hauses, meinte zu dieser Fehleinschätzung: »Um da skeptisch zu sein, muß man kein Experte sein. Die USA sind an einem substantiellen Technologietransfer einfach nicht interessiert.«
Nach Enthüllungen der britischen Zeitung The Independent on Sunday erlaubte der Labour-Premier Anthony Blair im Mai 2004 seinem Kriegskumpanen Bush, heimlich bodengestützte Raketen des NMD-Systems in der Nähe des Radarzentrums Fylingdales in Nordengland zu stationieren. Damit bekannte sich Blair zu dem Programm, das von den US-Amerikanern als »Son of Star Wars« (Sohn des Sternenkrieges) bezeichnet wird.
Heimatschutz am Hindukusch
Ende April diesen Jahres stimmte der Haushaltsausschuß des Bundestags mit den Stimmen von SPD, Grünen und Union einer Beteiligung am Projekt MEADS (Medium Extended Air Defense System – Mittelstrecken-Luftverteidigungssystem) zu, das seit Mitte der neunziger Jahre angestrebt wird. MEADS soll in den USA und der BRD die 25 Jahre alte PATRIOT (Phased Array Tracking to Intercept of Target – Phasengesteuerte Bahnverfolgung bis zum Zielabfang) und in Italien die noch ältere Nike Hercules ablösen. Über die PATRIOT schrieb die Fachzeitschrift Planet Aerospace 1/2002, daß sie »größere Wirkung in den Medien als im Ziel selbst« habe. MEADS ist Teil des NMD und soll gemeinsam von den USA, der BRD und Italien bis 2013 entwickelt werden. Am 1. Juni unterzeichnete das Industriekonsortium MEADS International mit der NATO-Agentur NAMEADSMA einen entsprechenden Vertrag. Damit sicherten sich die drei Mitgliedsunternehmen des Konsortiums‚ Lockheed Martin aus den USA, EADS/LFK aus der BRD und MEDA aus Italien einen Auftrag von 3,4 Milliarden Dollar allein für die Entwicklung. Von diesem Auftrag entfallen gemäß dem Finanzierungsbeitrag der einzelnen Länder 58 Prozent auf die USA, 25 Prozent auf die BRD und 17 Prozent auf Italien. Die Entscheidungen der Staaten über die wesentlich teurere Beschaffung – Schätzungen belaufen sich auf 20 Milliarden Dollar – werden 2008 bzw. im Jahr darauf erwartet.
MEADS ist ein mobiles, bodengestütztes und luftverlegbares Endphasen-abwehrsystem gegen Hubschrauber, Flugzeuge, Marschflugkörper sowie Kurz- und Mittelstreckenraketen mit einer Reichweite von 1000 Kilometern. Erklärte Aufgaben des teuren Waffensystems sind der Schutz des eigenen Territoriums vor Feinden und Terroristen sowie die Sicherung der Truppen im Auslandseinsatz. Wie unsinnig ein »Heimatschutz« ist, beweist ein Zirkelschlag mit einem Radius von 1000 Kilometer um Berlin: weit und breit kein einziger Feind; nur NATO- und EU-Partner oder neutrale Länder wie Schweden, Schweiz und Österreich, im Nordosten die neuen baltischen Freunde und im Südosten die orangefarbene Ukraine. Wie aber sollen die MEADS-Laster mit den Raketencontainern Terroristen stoppen, deren individuelle Möglichkeiten grenzenlos sind? Derselbe Zirkel um Kabul geschlagen, wo nach Meinung von Peter Struck (SPD) die BRD am Hindukusch verteidigt wird, erfaßt allerdings »Problemstaaten« wie Iran und Pakistan, China und Indien. Doch Skeptiker meinen, daß MEADS völlig überfordert sei und bestenfalls Gebieten von mehreren zehn Kilometern Durchmesser als Endphaseabwehrsystem absichern kann.
Struck unter Druck
Minister Struck steht unter doppeltem Druck. Seine Kollegen in Washington und Rom drängen auf Finanzen und Termine; in der rot-grünen KoaIition werden die Zweifel am Wert des Waffensystems immer größer. 850 Millionen Euro Entwicklungskosten müssen schnell beschafft werden. Die Beschaffungskosten für zwölf bis 24 MEADS der Bundeswehr betragen mindestens 2,85 Milliarden Euro. Doch das sind nicht die einzigen Sorgen des Genossen Struck. In einem Interview mit der Fachzeitschrift Raumfahrt Concret 4/5/2003 erklärte er: »Die Bundesrepublik Deutschland ist neben dem trilateralen Programm MEADS in die NATO-Studien zur Realisierung eines NATO-weiten Luftverteidigungssystems, das auch zur Abwehr von ballistischen Flugkörpern geeignet sein soll, integriert. Auch auf dem Gebiet der bilateralen Zusammenarbeit ist die Bundesrepublik Deutschland aktiv. So soll in einer solchen Kooperation ein Sensor zur Früherkennung des Starts von ballistischen Raketen entwickelt werden ...«
Die Führungsfähigkeit der Bundeswehr, auch im erweiterten Aufgabenspektrum, erfordert weitreichende Führungsmittel, insbesondere Satellitenkommunikation. Über Kommunikationssatelliten, einem Netz von Bodenstationen unterschied-licher Größe und Leistungsfähigkeit sowie einem Führungs- und Kontrollelement werden deutsche Kontingente in den Einsatzgebieten geführt – z. B. SPOR, KFOR, EF, ISAF etc.
Ein Beispiel dafür ist die Satellitenkommunikationsanlage der Bundeswehr mit dem Kürzel SATCOMBw. Der Sofortbedarf wurde 2003 mit einer Basis-Plattform gedeckt. Ein Langfristprogramm soll in den kommenden Jahren die noch bestehenden Defizite beseitigen durch eigene Satelliten, höhere Übertragungs-kapazitäten, Rund-um-die Uhr-Betrieb und hochmobile Bodenstationen; denn nur »dies sichert die Einsatzfähigkeit deutscher Streitkräfte außerhalb Deutschlands«, so Verteidigungsminister Struck.
Neben solchen Mitteln der Befehlsübertragung via Weltraum werden auch militärische Aufklärungs-, Navigations- und Wettersatelliten gefordert, um die Auslandsspionage zu verstärken und die Treffsicherheit der Waffensysteme zu erhöhen. GMES (Global Monitoring for Environment and Security – weltweite Umwelt- und Sicherheitskontrolle) heißt eine 2000 gestartete Initiative im Rahmen der europäischen Forschungs- und Technologieprogramme. Bis 2008 sollen die nationalen Kapazitäten so vernetzt werden, daß die WEU unabhängig vom GPS (Global Positioning System – Weltweites Ortungssystem) der US-Navy ist.
Seit 1998 betreibt das Raumfahrtunternehmen ORB-System AG in Bremen die Technologiestudie SAR-Lupe (Synthetic Aperture Radar – Radar mit künstlicher Strahlöffnung), eines licht- und wetterunabhängigen elektronischen Aufklärungssatelliten mit einer Bodenauflösung von weniger als einem Meter. Am 1. Januar 2002 erteilte das Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung (BWB) in Koblenz den Auftrag, zwischen 2005 und 2007 fünf dieser Himmelsspione zu starten sowie die dazugehörigen Bodenanlagen zu installieren. Die Dienstzeit des Systems wird mit zehn Jahren angegeben.
Rüstungsamt und Generalstab
»Nachdem bisher nur Frankreich eine nennenswerte militärische Raumfahrt hatte, entwickelt sich nun die europäische Ebene«, stellt Sven Knuth, Präsident der Mars Society Deutschland und Mitarbeiter von Jena Optronik, in derselben Ausgabe von Raumfahrt Concret fest, unter der Überschrift »Star Wars auch in Europa?« kommt er zu dem Ergebnis: »Neben der Raumfahrtpolitik kristallisiert sich langsam auch eine Sicherheitspolitik der Europäischen Union heraus, die EU ist auf dem Weg zu einem Militärbündnis.« Als Anzeichen dafür wertete der Autor folgende Aktivitäten:
– Vorbereitungen für die Gründung der EDRA (European Defense Research Agency – Europäisches Amt für Verteidigungforschung), einer »Europäischen DARPA« (Defense Advanced Research Project Agency – Agentur für fortge-schrittene Forschungsprojekte des Pentagon), in der die Rüstungbemühungen gebündelt werden.
– Einrichtung eines Militärkomitees beim Rat der EU, das die Planungs- und Auswertungskapazitäten der Teilnehmerländer für Einsätze koordiniert. Das Führungspersonal wird aus dem militärischen Stab rekrutiert, der ebenfalls beim Rat der EU angesiedelt ist. Die Diskussionen über ein militärisches Hauptquartier der EU sind im Gange.
– Arbeiten am ECAP (European Capability Action Plan – Einsatzplan für euro-päische Fähigkeiten) erwägen auch eigene Systeme zur Abwehr interkontinenta-ler ballistischer Raketen sowie eigene Trägerraketensysteme für militärische Raumflugkörper.
– Zwei EU-Einrichtungen, die von der Westeuropäischen Verteidigungsunion – ihrem militärischen Arm – übernommen wurden, unterstützen das Militär-komitee: das Institut für Sicherheitsfragen in Paris und das Satellitenzentrum Torrejon des Arduz östlich von Madrid. Sie dienen auch der Vorbereitung von Einsätzen der 60000 Mann starken EU-Eingreiftruppe. Auf El Hierro, der kleinsten Kanareninsel‚ gibt es eine Startrampe der USA für militärische Satelliten mit äquatorialen und polaren Umlaufbahnen.
Weltraum ohne Waffen
Im März 2005 empfahl eine Expertengruppe der EU den Sicherheitsanwendungen der Raumfahrt – sprich militärische Nutzung – höchste Priorität beizumessen. Nach dem Motto: »Global denken und lokal handeln« ... Die gegenwärtigen Auseinandersetzungen um eine Europäische Verfassung verdeutlichen auch den wachsenden Widerstand gegen eine Militarisierung auf der Erde und im Weltraum. Um einen neuen Rüstungswettlauf zu verhindern, fordern immer mehr Menschen »Space Without Weapons« (Weltraum ohne Waffen). Besorgte Wissenschaftler schlagen Schritte in drei Richtungen vor:
Erstens: Verbot von Stationierung und Einsatz aller Formen von Weltraumwaffen und Stärkung des UNO-Weltraumvertrages von 1967.
Zweitens: Verbot der Erprobung‚ Stationierung und des Einsatzes von Anti-Satellitenwaffen(ASAT) sowohl erdgestützt als auch weltraumgestützt.
Drittens: Einrichtung eines »Code of Conduct« (Regelkatalog) für friedens-erhaltende, nicht-offensive und nicht-aggressive Weltraumnutzung.
EADS, Rüstungskonzern Nummer eins in Europa
EADS: European Aeronautic Defense and Space Company –
Europäische Gesellschaft für Luftfahrt, Verteidigung und Raumfahrt
Nach Boeing der zweitgrößte Luft-, Raumfahrt- und Rüstungskonzern der Welt
Gründer: Das Unternehmen entstand am 10. Juli 2000 aus der Fusion von
DaimlerChrysler Aerospace AG (DASA), BRD, und Aerospatiale Matra, Frankreich
Construcciones Aeronáuticas SA (CASA), Spanien
Anteile: Streubesitz 34,1 %, DASA 30,2 %‚ SOGEADE (französische Holding) 30,2 %, SEPI (spanische Holding) 5,5 %
Börsen: Notierungen in Frankfurt/Main, Paris und Madrid
Status: Gesellschaft niederländischen Rechts (NV)
Beschäftigte: 110000 an mehr als 70 Produktionsstandorten vor allem in Frankreich (44000), BRD (37000), Großbritannien (16000) und Spanien (9000); 35 Außenbüros für Kunden
Spitzenmanager: 52, davon 25 Franzosen, 23 Deutsche und vier Spanier
Zentralen: Paris für Strategie, Marketing und Recht, München für Finanzen, Einkauf und Kommunikation
Geschäftsbereiche: Produkte und Beschäftigte
– Airbus (A 310 bis A 380) 48500
– Verteidigung und Sicherheits-Systeme (Eurofighter, Radar, EloKa: elektronische Kampfführung, LFK: Lenkflugkörper) 24000
– Luftfahrt (Eurocopter,Tiger) 16000
– Raumfahrt (Ariane 5, Galileo) 12300
– Militärische Transportflugzeuge (A 400 M) 3600
Töchter: EADS North America und EADS Russia
Horst Hoffmann
junge Welt vom 10.6.2005
erstellt von Frila - 18.06.2005
SIPRI-Jahrbuch: 2004 über eine Billion Dollar Rüstungsausgaben. USA einsame Spitze
Das Waffengeschäft boomt wie selten zuvor. Aus dem am Dienstag vorgestellten »Jahrbuch zu Rüstung und Abrüstung« des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) geht hervor, daß die weltweiten Rüstungsausgaben im vergangenen Jahr auf die rekordverdächtige Summe von 1,05 Billionen Dollar (844 Milliarden Euro) stiegen. Mit nahezu der Hälfte (47 Prozent) sind daran die USA beteiligt.
Insgesamt wuchsen die Militärausgaben seit 1995 global um 2,4 Prozent und seit 2002 um sechs Prozent jährlich. Inzwischen erreichen sie fast das Niveau aus Zeiten des Kalten Krieges. Die Rüstungsausgaben sämtlicher Staaten beliefen sich 2004 auf umgerechnet 162 Dollar (132 Euro) für jeden Menschen auf der Welt. Im Jahr zuvor hatten sie eine Gesamtsumme von 956 Milliarden Dollar erreicht.
Die USA dominieren sowohl die Produktion als auch den Verkauf von Rüstungsgütern. »Sie besitzen heute nach allen nur denkbaren Zählweisen eine klare Vormachtstellung«, sagte SIPRI-Direktorin Alyson J. K. Bailes am Dienstag. Allein die zusätzlichen Aufwendungen der US-Regierung für ihren »Krieg gegen den Terror« überstiegen seit 2003 mit 238 Milliarden Dollar alle Militärausgaben in Afrika, Lateinamerika und Asien (unter Einschluß Chinas, aber ohne Japan).
Mit 38 der hundert weltweit führenden Rüstungsproduzenten und einem Marktanteil von 63,2 Prozent (Zahlen für 2003) beherrschen die USA auch die internationale Waffenherstellung eindeutig. Derweil entfielen von den Gesamtverkäufen im Wert von 236 Milliarden Dollar 30,5 Prozent auf die 42 führenden europäischen Rüstungsunternehmen. Zu ihnen gehörten auch sechs russische Anbieter.
Dem Bericht zufolge vergrößerten sich die wichtigsten Waffenhersteller »enorm« und seien mittlerweile mit multinationalen Großunternehmen zu vergleichen. Die Umsätze der hundert führenden Waffenfirmen seien größer als das zusammengerechnete Bruttosozialprodukt der 61 ärmsten Länder der Welt. (AP/AFP/jW)
junge Welt vom 8.6.2005
erstellt von Frila - 18.06.2005
Pressemitteilung der Friedenskooperative zu 50 Jahre Bundeswehr
50 Jahre Bundeswehr sollte Anlass sein, die Aufgaben und auch die Armee selbst in Frage zu stellen.
Die Bundeswehr feiert in diesem Jahr selbstbewusst, aber nicht gerade selbst-reflexiv, ihr 50jähriges Bestehen. Regierungsamtlich wird durch die pompösen Feiern zur Bundeswehr als "Friedensarmee" erneut das falsche Paradigma der militärischen Lösung von Krisen und Konflikten in den Vordergrund gestellt. Mit den zahlreichen geplanten Jubiläumsausstellungen modernster Militärtechnik wie mit Minister Strucks Schwärmerei vom Soldaten der Zukunft "mit Waffe und Laptop" wird Werbung mit der technischen Faszination des Militärhandwerks betrieben und damit verbundener Krieg und Zerstörung ausgeblendet. Mit Zapfenstreichen und Gottesdiensten für die Armee werden preußische Traditionen und Rituale neu belebt, die spätestens seit Wehrmachtszeiten völlig diskreditiert sein sollten.
Der oberste Dienstherr Struck fordert gleichzeitig mehr gesellschaftliche Diskussion um mögliche Kampfaufträge mit toten deutschen Soldaten und die Aufgaben der Bundeswehr bei Friedenserzwingung und Verteidigung Deutschlands am Hindukusch. Recht hat er. Diese Diskussion ist nötig. Die Serie der Bundeswehrfeiern bis zum November 2005 wird von Aktionen der Friedensbewegung begleitet werden, die sich gegen Verherrlichung von Militärtechnik wenden, die Rolle der Bundeswehr als Interventionsarmee und das Dogma der "humanitären Intervention" hinterfragen und das Primat ziviler Konfliktbearbeitung einklagen.
Die Bundeswehr steht in ihrem 50sten Jahr auch in einer Legitimationskrise. Nach Wegfall der Landesverteidigung als primäre Aufgabe werden ihre immensen Kosten mit dem militärisch nicht zu gewinnenden "Krieg gegen den Terror", "friedenserzwingenden Maßnahmen", also Krieg mit UNO-Mandat, und Waffenstillstandsüberwachungen gerechtfertigt. Dagegen fragen Organisationen aus der Friedensbewegung, ob Bekämpfung des internationalen Terrorismus wie auch von Krisen und Kriegen nicht bei einer Umverteilung von Geld und Ressourcen auf zivile und politische Anstrengungen effektiver und mit weniger zivilen Opfern gelingen könnten. Tatsächlich sollte die gesellschaftliche Diskussion um die Bundeswehr neu beginnen.
Manfred Stenner
Geschäftsführer des Netzwerk Friedenskooperative
erstellt von Frila - 10.06.2005
Pressemitteilung
Abzug aller Atomwaffen aus Deutschland: Von Rot-Grün und FDP gefordert - Bundesregierung kneift - NATO-Gipfel ohne Diskussion? -
Dringlichkeitsaktion der Friedensbewegung
Kassel, 7. Juni - Die Friedensbewegung ist empört über die Umfallerqualitäten von rot-grüner Bundesregierung und FDP, erklärte ein Sprecher des Bundesausschusses Friedensratschlag am Dienstag in Kassel. Stein des Anstoßes: Noch vor wenigen Wochen haben Verteidigungsminister Peter Struck, Außenminister Fischer und FDP-Vorsitzender Westerwelle versprochen, sich für den Abzug der in Büchel (Rheinland-Pfalz) gelagerten US-Atomraketen aus Deutschland einzusetzen. Jetzt scheinen sie bereits wieder den Schwanz einzuziehen, sagte Peter Strutynski.
Das sind die Fakten und Versprechungen:
(1) In Deutschland lagern bis zu 150 US-Atomraketen, davon 130 in Ramstein und 20 in Büchel. Nach neuesten Informationen des SPIEGEL sollen die 130 Atomsprengköpfe aus Ramstein bereits abgezogen worden sein, sodass nur noch die 20 Sprengköpfe in Büchel übrig wären. Eine offiziellen Bestätigung dafür fehlt allerdings.
(2) Vor der Überprüfungskonferenz des Atomwaffensperrvertrags erhob die FDP die Forderung, die USA mögen doch die Atomwaffen aus Deutschland abziehen. Einem Antrag an den Bundestag vom 12. April 2005 zufolge soll die Bundesregierung "bei den amerikanischen Verbündeten darauf (zu) drängen, dass die bis heute in Deutschland stationierten taktischen Nuklearwaffen der USA abgezogen werden".
(3) Am 29. April erklärte die Grünen-Fraktion in einer Pressemitteilung u.a.: "Ein rascherer Verzicht auf die nukleare Teilhabe und ein vollständiger Abzug der US-Atomwaffen aus Europa könnten den Bemühungen um nukleare Abrüstung und Nonproliferation neue und wichtige Impulse geben."
(4) Und der außenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Gert Weisskirchen, äußerte sich wenig später in einem Zeitungsinterview folgendermaßen: "Die Parlamentarier sind dazu da, klar und deutlich zu sagen, was nötig ist. Das bedeutet auch: die Atomwaffen auf deutschem Boden zum Verschwinden zu bringen." (Frankfurter Rundschau, 3. Mai 2005)
(5) Außenminister Joschka Fischer nannte die Forderung, die verbliebenen Nuklearwaffen aus Deutschland abzuziehen, "eine vernünftige Initiative", mit der sich die Bundesregierung "ernsthaft" befassen werde (AFP, 2. Mai 2005). Verteidigungsminister Peter Struck kündigte kurz darauf an, "dass wir in den Gremien der NATO dieses Thema ansprechen werden" und meinte: "Wir werden das in Absprache mit den anderen Verbündeten, in deren Ländern auch noch Atomwaffen stationiert sind, zu klären haben." (dpa, 6. Main 2005)
Das ist der Umfaller der Woche:
Am Donnerstag und Freitag, den 9. und 10. Juni 2005, treffen sich in Brüssel die Verteidigungsminister der NATO-Staaten und die Nukleare Planungsgruppe der NATO. Das wäre der geeignete Ort, um den deutschen Wunsch nach einem Abzug der Atomwaffen sowie nach Beendigung der atomaren Teilhabe vorzubringen. Der belgische Verteidigungsminister ließ inzwischen aber wissen, dass Peter Struck in dieser Angelegenheit nicht mit ihm Kontakt aufgenommen habe und das Thema bislang auch nicht auf der Tagesordnung des NATO-Treffens stehe. Für die rot-grüne Koalition hat die Forderung nach Abzug aller US-Atomwaffen aus Deutschland offenbar keine Dringlichkeit mehr. Nach einem "Spiegel-Online"-Bericht vom 4. Juni will Berlin das Thema definitiv nicht auf die Tagesordnung der Nuklearen Planungsgruppe der NATO setzen.
Das ist ein Skandal: Auf der einen Seite wochenlang in der Öffentlichkeit posaunen, dass sich die Bundesregierung für den Abzug der Atomwaffen einsetzen werde, und auf der anderen Seite den Schwanz einziehen, wenn die Gelegenheit dazu bestünde. Dies auch noch mit dem bevorstehenden Wahlkampf zu begründen, wie es der "Spiegel" nahelegt, grenzt an rot-grünen Selbstmord. Nach Umfragen von Meinungsforschungsinstituten sind bis zu 95 Prozent der Bevölkerung hier zu Lande für den Abzug der Atomwaffen. Möchte die abdankende Regierung nur noch bei den verbliebenen fünf Prozent punkten?
Heute und morgen beteiligen sich viele Friedensinitiativen unter dem Dach des Trägerkreises "Atomwaffen abschaffen - bei uns anfangen!", dem auch der Bundesausschuss Friedensratschlag angehört, an einer Dringlichkeitskampagne, mit der Verteidigungsminister Struck, Außenminister Fischer und Bundeskanzler Schröder per e-mail oder Fax zur Einlösung ihres Versprechens aufgefordert werden. Die e-mail-Aktion kann über das Internet erfolgen, und zwar über die "Pressehütte Mutlangen": www.pressehuette.de.
Für den Bundesausschuss Friedensratschlag:
Peter Strutynski (Sprecher)
erstellt von Frila - 10.06.2005
von Gerhard Hegmann, München
Der französische Thales-Konzern baut in Deutschland ein computer-gestütztes Simulationszentrum für Kriegsszenarien auf. Darin lässt sich das Zusammenspiel verschiedener Truppenteile einschließlich der Informationsnetze realitätsnah durchspielen.
Mit ein paar Mausklicks lassen sich verschiedene Manöver in beliebigen Regionen simulieren und bewerten. Wie Martin van Schaik, Vorsitzender der Thales-Sparte Battlespace Transformation Center, auf Anfrage sagte, solle das Demon-strationszentrum bis zum Herbst in der Nähe des Bundeswehr Beschaffungsamtes in Koblenz entstehen. "Wir können damit die Bundeswehr bei ihrer Umstellung auf neue Technologien unterstützen", sagte van Schaik.
Das neue Zentrum soll Thales helfen, den Umsatz in Deutschland anzukurbeln, der 2004 rund 500 Mio. Euro betrug. Der Konzern will den Umsatz in diesem Markt verdoppeln, hat sich dabei aber nicht auf einen Zeitrahmen festgelegt.
Ähnliche Simulationszentren hat Thales bereits in Frankreich, Großbritannien, den Niederlanden und Australien errichtet. "Weitere Zentren werden folgen", so van Schaik.
Wachstumsmarkt der Rüstungsindustrie
In Deutschland gibt es bereits erste Überlegungen, das Projekt zu einem großen nationalen Simulationszentrum für Krisenszenarien auszubauen. Vorbild ist Frankreich, wo ein Thales-Konsortium mit einem Auftrag in Höhe von 135 Mio. Euro vom Pariser Verteidigungsministerium rechnet. Dort hat das so genannte Boa-Programm größere Dimensionen und technische Kapazitäten als das Testzentrum in Koblenz.
Auch der Luftfahrtkonzern EADS hat in Deutschland und Frankreich erste Simulationseinrichtungen, so genannte Netcos-Zentren. Wie Thales-Manager van Schaik sagte, "ist es aber sicher nicht im Interesse des Verteidigungsministeriums, sich auf ein System zu verlassen. Wir möchten uns gerne beteiligen, wenn in Deutschland ein großes Zentrum errichtet wird."
Thales verfolge eine offene Systemarchitektur, in der andere Firmen wie der Prüfkonzern IABG ihre Technik anknüpfen könnten.
Die elektronische Vernetzung der Streitkräfte gilt als Wachstumsmarkt der Rüstungsindustrie. Ein 2004 gegründetes transatlantisches Industriekonsortium (NCOIC) legt derzeit die Standards für einen Datenaustausch fest. Zu dem Konsortium gehören 65 Konzerne und Organisationen wie Boeing, Lockheed Martin, EADS, Thales, IBM, Cisco und Microsoft. Im Mai kam der US-Chipkonzern Intel hinzu. Der Markt wird bis 2015 auf rund 200 Mrd. $ geschätzt.
Financial Times Deutschland vom 8.6.2005
erstellt von Frila - 10.06.2005
Uranhaltige Munition gilt als Urheber von Missbildungen in Irak
Von Karin Leukefeld
Ein Bericht des Integrierten Regionalen Informationsnetzwerkes (IRIN) der Vereinten Nationen griff vor wenigen Tagen ein international weit gehend tabuisiertes Thema auf. »Ärzte warnen vor einer Zunahme von Missbildungen bei Neugeborenen« in Irak, hieß es da, doch das Thema ist durchaus nicht neu.
Der erste Irak-Krieg ist seit 14 Jahren vorbei, doch seine Auswirkungen bestehen fort. Seit 1994 beobachten irakische Ärzte und Wissenschaftler, dass besonders in den südlichen Provinzen Iraks, Basra, Muthanna, Mathain und Nadschaf, Missbildungen und Krebsfälle bei Kindern und Neugeborenen drastisch zunahmen. Nicht nur irakische Ärzte äußerten seitdem wiederholt die Vermutung, dass die aus abgereichertem Uran hergestellte Munition der alliierten Streitkräfte aus dem Krieg 1991 dafür verantwortlich sei. Der radioaktive Staub gelangt nach einer Explosion mit Wind und Regen in Wasser und Boden und erreicht so über die Nahrungskette die Menschen.
Die Fälle von Missbildungen und Krebs wurden gewissenhaft dokumentiert. Auf grauenhaften Bildern im Archiv des Zentralen Krankenhauses in Basra waren Neugeborene mit nur einem Auge, mit einer Fleischmasse anstelle eines Kopfes, mit offenem Rücken und anderen schweren Schädigungen zu sehen. Die Frauen waren damals so schockiert, dass viele keine Kinder mehr bekommen wollten, doch im Westen ging man davon aus, dass es sich um Propaganda des Saddam-Hussein-Regimes handele.
Die USA-Armee gab inzwischen die Menge der 1991 verwendeten uranhaltigen Munition mit mehr als 300 Tonnen an. Bei der Invasion im Jahre 2003 wurde erneut solche DU-Munition eingesetzt, wie die britische Regierung auf eine entsprechende parlamentarische Anfrage bestätigte.
In dem nun von IRIN veröffentlichten Bericht sagte Dr.Nawar Ali vom Zentralen Lehrkrankenhaus der Bagdad Universität, dass es seit August 2003 allein in den staatlichen Krankenhäusern Bagdads insgesamt 650 Fälle von missgebildeten Neugeborenen gegeben habe. Das sei ein Anstieg um 20 Prozent gegenüber der Zeit vor der USA-Invasion. Untersuchungen aus privaten Kliniken seien nicht bekannt. In vielen Fällen seien sowohl der Vater als auch die Mutter der Neugeborenen uranhaltiger Munition ausgesetzt gewesen, ergänzte sein Kollege Dr. Ibrahim al-Jaburi.
Die neu registrierten Missbildungen bei Neugeborenen im Lehrkrankenhaus der Bagdad Universität ähneln denen der Kinder aus Basra Mitte der 90er Jahre: Hände mit mehr als fünf Fingern, Riesenköpfe, eine oder gar keine Lippen, keine Arme, keine Beine. 90 Prozent der Kinder werden nicht älter als eine Woche, berichtet der Arzt Wathik Ibrahim.
»Zwei meiner Kinder waren bei der Geburt missgebildet«, erzählt Fatima Hussein, eine 34-jährige Frau im Krankenhaus des Roten Halbmondes, die gerade von einem dritten, wieder missgebildeten Kind entbunden worden ist. Die Ärzte machen auch in ihrem Fall radioaktive Verseuchung verantwortlich, doch ihrem Mann ist das egal. »Er sagt, ich sei nicht in der Lage, gesunde Kinder zu gebären, nun will er sich scheiden lassen.«
Im April 2005 wurden im Krankenhaus des Roten Halbmondes 15 missgebildete Babys geboren, fast vier Fälle pro Woche. Die Analyse der Familiengeschichten lasse den Schluss zu, dass 60 Prozent der Fälle auf radioaktive Verseuchung in Südirak zurückzuführen seien.
Neues Deutschland, 3.6.2005
erstellt von Frila - 10.06.2005
250.000 Kindersoldaten sind in 20 Ländern im Kampfeinsatz
Von Wolfgang Kötter
Sogenannte konventionelle Waffen werden seit Jahrhunderten als Tötungs-instrumente eingesetzt, doch hat sich das Problem seit dem Ende des Ost-West-Konflikts dramatisch verschärft. Riesige Rüstungsberge wurden plötzlich überflüssig, und ein Großteil dieser Waffen breitet sich durch geheime Kanäle wie Metastasen auf dem Erdball aus. Das Genfer Institut für Internationale Studien schätzt die Gesamtmenge an „Kleinwaffen und leichten Rüstungen“ auf über 640 Millionen. Sie gehören zum Teil zur Ausrüstung von Armeen und Polizei oder befinden sich offiziell im Privatbesitz. Ein beträchtlicher Anteil wird aber auch illegal gehandelt und angewendet.
Die unkontrollierte Verbreitung von Kleinwaffen gehört zu den größten Herausforderungen der gegenwärtigen internationale Politik. Noch zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts waren 90 Prozent der in Kriegen Verletzten oder Getöteten Soldaten. Heute hat sich das Verhältnis nahezu umgekehrt und Zivilisten machen vier Fünftel der Opfer aus. Für die Zivilbevölkerung sind Kleinwaffen in hohem Grade tödlich. Nach Untersuchungen des Internationalen Roten Kreuzes werden in militärischen Konflikten „nur“ fünf Prozent der betroffenen Zivilisten Opfer von großen Waffensystemen wie Panzer und Flugzeuge. Weitere zehn Prozent werden durch Minen und noch einmal soviel durch Artillerie- und Mörsergeschosse getötet oder verletzt. Mit 70 Prozent den größten Opferanteil verursachen jedoch Handfeuerwaffen. Allein in gewaltsamen Konflikten fordern Kleinwaffen jährlich Dreihunderttausend Menschenleben. Weitere Zweihunderttausend Menschen sterben durch Mord, Gewaltkriminalität und Suizid. Kleinwaffen sind billig, Sturmgewehre beispielsweise werden mancherorts schon für weniger als 15 Dollar verkauft, oft auch nur für einen Sack Weizen. Sie sind einfach zu bedienen, unaufwendig zu transportieren und zu verstecken. Da sie nur wenig gewartet werden müssen, können sie oft jahrzehntelang benutzt werden und tauchen immer wieder auf neuen Brandherden auf. So sind etwa chinesische und russische Maschinenpistolen Kalaschnikow sowie amerikanische M16 Sturmgewehre aus der Zeit des Vietnamkrieges immer noch in Südostasien im Einsatz, während auf dem Balkan Infanteriegewehre aus dem zweiten Weltkrieg Verwendung finden. Bringen schon zwischenstaatliche Kriege unermessliches Leid über die betroffenen Menschen, so entstehen besonders verheerende Folgen, wenn die Waffen in die Hände von Terroristen, irregulären Milizgruppen oder auch kriminellen Waffennarren fallen. Dann werden Konflikte verschärft, Flüchtlingsströme entstehen und Gewalttaten bleiben ungeahndet. Kleinwaffen sind deshalb ebenso eine Bedrohung für Frieden, Stabilität und Entwicklung wie auch für Demokratie und Menschenrechte. Nicht zuletzt bedeuten sie große wirtschaftliche und soziale Verluste. Vor allem aber sind Kleinwaffen tödlich und die überwiegende Mehrheit der Opfer sind Frauen und Kinder.
Opfer und Täter zugleich: Kindersoldaten
Es gehört zu den grausamsten Abscheulichkeiten dieser Welt, dass skrupellose Warlords ausgerechnet Kinder zu Opfern und gleichzeitig auch zu Tätern verdammen. Trotz leichter Verbesserungen im vergangenen Jahr sind immer noch über 250.000 Kindersoldaten in 20 Ländern im Kampfeinsatz (siehe Übersicht). Schon ein zehnjähriges Kind kann mit einer Maschinenpistole töten, denn diese Waffen wiegen wenig und sind „kinderleicht“ zu bedienen. Heute gehen neun von zehn Kriegsopfern auf ihr Konto. Die Kalaschnikows und G-3-Gewehre sind „die Massenvernichtungswaffen unserer Zeit“, meint Dietrich Gerlichs, Geschäftsführer des UN-Kinderhilfswerks UNICEF in Deutschland. Die meisten Kindersoldaten werden von Rebellenarmeen für den Kampf gegen die staatliche Ordnung rekrutiert, oft gewaltsam und unter Alkohol- oder Drogeneinfluss. Zuweilen unterstützen sogar Regierungen paramilitärische Milizen, die Minderjährige in den Krieg schicken oder zu Gewalttaten gegen die Zivilbevölkerung anstacheln. Kinder und Jugendliche werden als Kämpfer geschätzt, weil sie loyal, billig und manipulierbar sind. Oft zwingt man sie zu harter Arbeit, Plünderungen, Gewalt, und Mord, oder missbraucht sie als Sexsklaven. Nur wenige Kindersoldaten kämpfen freiwillig aus religiösen oder politischen Motiven. Die meisten haben Angst vor Übergriffen des Gegners und vor Misshandlungen durch eine Kriegspartei. Viele hoffen auf Schutz, Sicherheit und Versorgung. Nicht zu unterschätzen ist, dass Waffenbesitz Machtgefühl verleiht und man mit Gewalt rauben und plündern kann. Zuweilen aber melden sich Kinder auch ohne Zwang, weil sie sich für die Ermordung der Eltern oder von Familienangehörigen rächen wollen. Einen erschütternden Bericht vermittelt der auf der diesjährigen Berlinale uraufgeführte Dokumentarfilm "Lost Children". Er handelt von Kindersoldaten im Norden Ugandas, wo die Lord's Resistance Army, eine der brutalsten Guerillatruppen der Welt, Tausende Kinder im Jahr verschleppt, um aus ihnen gefügige und grausame Monster zu machen. Im Aufnahmelager Pajule erzählen die Kinder Sozialarbeitern der Caritas von ihren traumatischen Erlebnissen, von der Gewalt, der sie ausgesetzt waren und vom Terror, den sie selbst verübt haben. Der Film zeigt bedauernswürdige aber gleichzeitig auch grauenhafte Kreaturen. Aus Angst wollen manchmal selbst die eigenen Eltern ihre zurückgekehrten Kinder nicht wieder aufnehmen. In den nordöstlichen Provinzen des Kongo Ituri und Kivu haben marodierende Jugendliche, die angestachelt von Stammes-Milizen Dörfer anzünden, Massenvergewaltigungen begehen, Ernten stehlen und Reisende ausrauben, die gesellschaftliche Ordnung völlig zusammenbrechen lassen. Im Gegenzug sollen bei Militäraktionen der MONUC-Friedenstruppen gegen die Milizen auch Kinder getötet worden sein. Seit drei Jahren verbietet ein Zusatzprotokoll zur UN-Kinderrechtskonvention den Kriegseinsatz unter 18 Jahren. Bis heute haben 117 Staaten das Abkommen unterzeichnet und 97 ratifiziert. „Eine Welt ohne Kindersoldaten ist möglich, die ersten Schritte sind getan. Noch aber fehlt oft der politische Wille,“ bemängelt Andreas Rister, Sprecher der Deutschen Koordination Kindersoldaten.
Freie Waffenkäufe für freie Bürger!
"Ich werde Menschen jagen", sagte James Huberty aus dem kleinen Ort San Ysidro im US-Bundesstaat Kalifornien am 18. Juli 1984 zu seiner Frau. Dann ging er zum nächsten McDonald's-Restaurant und schoss ziellos um sich. Im Kugelhagel wurden 21 Menschen getötet und 19 weitere verletzt. Auch in den Jahren nach dem sogenannten "McDonald's-Massaker" kam es zu Blutbädern durch Schnell-feuerwaffen. Ein tödliches Wochenende mit zwei Verbrechen und insgesamt zwölf Toten versetzte im vergangenen März das ganze Land in Angst und Schrecken. Während eines Kirchentreffens in Brookfield bei Milwaukee im Bundesstaat Wisconsin erschoss der 45 Jahre alte Terry Ratzmann am 12. März sieben Glaubensbrüder der „Living Church of God“, darunter den Pastor, und sich selbst. Vier weitere Menschen wurden schwer verletzt. Kurz zuvor war die größte Verbrecherjagd in der Geschichte des Bundesstaates Georgia zu Ende gegangen. Der 33-jährige Brian Nichols hatte im Amtsgericht von Atlanta den Richter und zwei Beamte erschossen, eine Polizistin lebensgefährlich verletzt und war danach entkommen. Während der Verfolgung tötete er noch einen Zollbeamten und raubte dessen Waffe und Auto, bevor er sich nach 26 Stunden langer Flucht der Polizei stellte. In einem Indianer-Reservat im Bundesstaat Minnesota tötete der 17-jährige Schüler Jeff Weise am 21. März neun Menschen und richtete sich danach selbst. Zuvor hatte er seine Großeltern ermordet. Offenbar mit den Waffen seines Großvaters, eines ehemaligen Polizisten, schoss er dann zuerst auf einen Wachmann der Highschool des kleinen Ortes Red Lake, danach tötete er eine Lehrerin und mehrere Mitschüler. Die jüngste Schreckensmeldung kommt aus dem US-Staat Ohio. Dort hat vor gut einer Woche der 18-jährige Scott Moody fünf Menschen und anschließend sich selbst erschossen. Die sechs Leichen waren in zwei Bauernhäusern in der Kleinstadt Bellefontaine im Bezirk Logan entdeckt worden. In den USA sterben jährlich Tausende Menschen durch Feuerwaffen. Die Regierung verhängte darum im Jahre 1994 ein Verbot für 19 Arten der schlimmsten Mordinstrumente, hauptsächlich Sturmgewehre und Maschinen-pistolen. Im Buhlen um Wählerstimmen ließ der republikanisch dominierte Kongress während des Präsidentenwahlkampfes im vergangenen September das Verbotsgesetz jedoch auslaufen. Trotz Terrorgefahr, der von der Regierung geschürten Angst vor Attentaten und überall verschärften Sicherheits-bestimmungen ist damit die allgemeine Lizenz zum Schießen erteilt und das „Bürgerrecht“ auf uneingeschränkten Waffenkauf wieder hergestellt. Die Speerspitze der Waffenfreaks in den USA bildet die mächtige „National Rifle Association“ (NRA) mit vier Millionen Mitgliedern. Zur Zeit wirbt die Organisation für das „Guns-in-Bars Gesetz“ in Arizona. Entgegen dem jetzigen Verbot soll zukünftig jedermann das Recht haben, mit einer geladenen Waffe eine Bar oder ein Restaurant zu betreten - sofern er keinen Alkohol konsumiert. Auch in Deutschland kam es wiederholt zu bewaffneten Gewalttaten. Beim Amoklauf des ehemaligen Schülers Robert Steinhäuser starben in einem Erfurter Gymnasium am 26. April 2002 dreizehn Lehrerinnen und Lehrer, zwei Schüler und ein Beamter durch Pistolenschüsse. Vier Menschen wurden verletzt. Am 7. März diesen Jahres schoss Ein 14-Jähriger an einer Schule im bayerischen Rötz mit einer scharfen Waffe auf seinen Lehrer, verfehlte ihn jedoch. Den Revolver hatte der Jugendliche aus dem Waffenschrank seines Vaters entwendet.
Gegen uneingeschränkte Lizenz zum Schießen
Trotz der verheerenden Auswirkungen, kommen die Bemühungen um eine Eindämmung der Waffenflut nur schleppend voran. Starke Waffenlobbys sabotieren auf nationaler wie auch auf internationaler Ebene jegliche Restrik-tionen und bremsen die jeweilige Regierungspolitik. Vor vier Jahren widmete die UNO dem Problem der Kleinwaffen erstmals eine Weltkonferenz. Sie richtete sich nicht, wie die Waffenlobby behauptete, gegen die souveräne Entscheidung der Regierungen über die Bewaffnung ihrer Polizei und Sicherheitskräfte. Sie zielte auch nicht darauf ab, das Recht der Staaten auf Verteidigung zu beschränken, das Selbstbestimmungsrecht zu untergraben oder rechtmäßigen Besitzern ihre Waffen zu nehmen. Es ging, wie UNO-Generalsekretär Kofi Annan betonte, „gegen skrupellose Waffenhändler, korrupte Beamte, Drogenkartelle, Terroristen und andere Gruppen, die weltweit Tod und Chaos auf Straßen, in Schulen und Städte bringen.“ Doch das verabschiedete Aktionsprogramm wurde vor allem von den USA verwässert, die Restriktionen für den privaten Waffenbesitz und ein Verbot von Waffenlieferungen an paramilitärische Rebellengruppen blockierten. Ein Nachfolgetreffen konnte ebenfalls nur minimale Fortschritte erreichen und endete mit einem unverbindlichen Appell zu mehr Kooperation.
Zur Zeit verhandelt eine Arbeitsgruppe unter Leitung des Schweizer Diplomaten Anton Thalmann über einen ersten Schritt zur Eindämmung der Waffenflut. Der Entwurf für ein Rechtsinstrument gegen den illegalen Handel mit Kleinwaffen soll der im Juli tagenden Weltkonferenz über Kleinwaffen zur Entscheidung vorgelegt werden. Die Experten stehen jedoch vor einem Dilemma. Sie müssen nach einer völkerrechtlichen Regelung suchen, die die Waffenschwemme wirksam eingrenzt, aber dennoch keine völlige Beseitigung aller Kleinwaffen anstreben kann. Denn eine bestimmte Menge wird für die Ausrüstung der regulären Streitkräfte wie auch zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung weiterhin erforderlich sein. Wenn das jedoch legitim ist, müssen einzelne Staaten ebenfalls das Recht besitzen, die entsprechenden Waffen zu erwerben bzw. zu verkaufen. Trotzdem könnte zumindest der illegale Handel mit diesen Waffen eingedämmt werden, wenn es gelingt, verborgene Waffenströme sichtbar zu machen. „Skandalös” findet Anna MacDonald von der britische Hilfsorganisation Oxfam, “dass man eine größere Chance hat, die Herkunft einer genmanipulierten Tomate oder eines Handkoffers aufzuspüren als die einer Kalaschnikow oder eines Raketenwerfers.“ Wenn es jedoch gelingt, die Wege von Waffen zurückzuverfolgen bis zu dem Punkt, an dem sie die legale Kette verlassen, könnte das zumindest die Kontrolle und Eindämmung der illegalen Waffenströme erleichtern. Am 13. August vergangenen Jahres wurden bei einem Massaker im burundischen Flüchtlingslager Gatumba 160 kongolesische Flüchtlinge getötet und über 100 verletzt. Die Patronenhülsen offenbarten deren Produktionsstätten in Bulgarien, China und Serbien. Wie die Munition in die Hände der Mörder kam, blieb ungeklärt. „Jeden Tag sammelt amnesty international entsetzliche Beweise für Menschenrechtsverletzungen in aller Welt“, beklagt die britische Direktorin der Organisation, Kate Allen. „Ein System der Kennzeichnung und Nachverfolgbarkeit von Waffen würde die erforderlichen Belege liefern, um festzustellen, wer für die Bewaffnung der Täter verantwortlich ist.“
Den Nichtregierungsorganisationen wie Oxfam, amnesty international und dem Internationalen Aktions-Netzwerk gegen Kleinwaffen (IANSA) geht eine solche Vereinbarung jedoch nicht weit genug. In ihrer gemeinsamen Studie "Tödlichen Gütern auf der Spur" fordern sie zwar alle Regierungen zur Unterstützung des angestrebten Vertrages als einem wichtigen ersten Schritt auf. Notwendig wären aber nicht nur verbindliche Verpflichtungen zur einheitlichen Kennzeichnung der Waffen und Munition mit Seriennummern, dem Nachweis ihrer Hersteller, sondern auch zur Registrierung der Waffenmakler, der Empfänger und zu einer korrekten Buchführung über die Verbreitungsstationen. Rechtsvorschriften wären zu erlassen, die die unerlaubte Produktion und den illegalen Besitz von Waffen unter Strafe stellen. Ausgehandelt werden müssen außerdem Auflagen zur sicheren Lagerung von Waffen, strikte Ex- und Importüberwachung und strenge Endverbleibsregelungen. Zertifikate über Erstliferanten und Endnutzer würden die Einhaltung von Waffenembargos und regionaler Vereinbarung gegen den illegalen Waffenhandel erleichtern. Nationale Behörden könnten Aktionen gegen Kleinwaffen auch über Ländergrenzen hinaus effektiv koordinieren. Über derartige Transparenzmaßnahmen hinaus müssen aber auch die bereits bestehenden riesigen Waffenlager abgebaut werden. In Ländern, in denen Kämpfe beendet wurden, kommt es darauf an, die ehemaligen Kombattanten zu entwaffnen, aus ihren Kampfeinheiten zu entlassen und durch die Schaffung von Arbeitsplätzen zu resozialisieren. Gemeinsam mit anderen Nichtregierungs-organisationen, kooperativen Staaten und Rechtsexperten erarbeitet die britische Abrüstungsorganisation „Saferwold“ jetzt ein umfassendes Rahmenabkommen zum internationalen Waffenhandel. Die spezifischen Vertragsbestimmungen basieren auf rechtsverbindlichen “Kernprinzipen” wie: Keine Waffen für Völkerrechtsverletzungen, Beachtung der Menschenrechte und des humanitären Völkerrechts sowie die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung.
„Kleinwaffen und leichte Rüstungen“ sind eine bestimmte Kategorie von Kampfmitteln, die von einer oder zwei Personen getragen, transportiert und ausgelöst werden können. Zu ihnen zählen laut UNO-Definition: Sturmgewehre, Revolver und Maschinengewehre sowie die dazugehörige Munition, aber auch Handgranaten, tragbare Raketenwerfer, Mörser, Panzerfäuste, Minen und schultergestüzte Flugabwehr-Raketen.
Der von führenden Kinder- und Menschenrechtsorganisationen vorgelegte "Weltbericht 2004" nenn als Länder, in denen Kindersoldaten im Einsatz sind: Afghanistan, Angola, Burundi, Kongo, Kolumbien, Elfenbeinküste, Guinea, Indien, Irak, Israel/palästinensische Autonomiegebiete, Indonesien, Liberia, Myanmar, Philippinen, Russland, Ruanda, Sri Lanka, Somalia, Sudan und Uganda.
Rund 1.250 Unternehmen in mehr als 90 Ländern produzieren jährlich acht Millionen neue Kleinwaffen und deren Munition. Die größten Händler von Kleinwaffen sind die USA, Italien, Belgien, Deutschland, Russland, Brasilien und China. Darüber hinaus wird die Herstellung von Kleinwaffen in Länder wie Iran, Pakistan und Singapur vermutet, allerdings sind deren Exporte für internationale Untersuchungen nicht transparent.
Quelle: Webseite des Friedensratschlags (
www.friedensratschlag.de)
erstellt von Frila - 10.06.2005
Pressemitteilung
Heidelberg/Stuttgart, 31. Mai 2005
Überraschende Post erhielt der Atomwaffengegner Hermann Theisen aus Heidelberg Ende letzter Woche vom Landgericht Heidelberg. Im Beschluss vom 24. Mai wird die bei ihm durchgeführte Hausdurchsuchung vom 22. April als rechtswidrig angesehen und die "Beschlagnahme von 1800 Flugblättern" aufgehoben. Damit folgt sie der Beschwerde Theisens und verwarf den Beschluss zur Hausdurchsuchung des Amtsgerichts Heidelberg vom 15. März. In den Flugblättern werden alle Soldaten dazu aufgerufen, sich der "völker- und grundgesetzwidrigen" nuklearen Teilhabe in Büchel zu verweigern.
"Ich bin erleichtert über diese Entscheidung. So teilt nach dem Freispruch des Landgerichts Koblenz am 29. März ein zweites Gericht meine Einschätzung, dass das Flugblatt nicht den Tatbestand der öffentlichen Aufforderung zu Straftaten erfüllt" beschreibt Hermann Theisen. Das Landgericht kommt zu dem Schluss, "dass sich der Inhalt des Flugblatts angesichts der kontrovers geführten Diskussion zur Frage des Einsatzes von Nuklearwaffen noch im Rahmen der freien Meinungsäußerung bewegt."
"Ich zweifle daran, dass nun die Revision der Staatsanwaltschaft Koblenz gegen meinen Freispruch vom 29. März vor dem Oberlandesgericht Erfolg haben wird" so Theisen. So argumentiere das Landgericht zurecht, dass ein wesentlicher Aspekt des Flugblatts sei, "die Adressaten (die Bundeswehrsoldaten in Büchel) für die eigene pazifistische und jedenfalls jeglichen Einsatz von Nuklearwaffen gar zu Präventivschlägen ablehnende Meinung zu gewinnen."
Im Zuge der aktuellen Debatte über die Lagerung von Atomwaffen in Deutschland (Büchel und Ramstein) und der breit erhobenen Forderung nach deren Abzug sowie der Beendigung der nuklearen Teilhabe unterstützt die Gewaltfreie Aktion Atomwaffen Abschaffen eine mailaktion der Pressehütte Mutlangen (www.pressehuette.de). Damit sollen Bundeskanzler Schröder, Außenminister Fischer und Verteidigungsminister Struck an ihr Versprechen von Anfang Mai erinnert werden, die Stationierung von US-Atomwaffen in Deutschland in der Nato zum Thema zu machen. "Gelegenheit dazu ist auf dem nächsten Treffen der nuklearen Planungsgruppe am 9. und 10. Juni in Brüssel" heißt es in der mail.
Kontakt:
Hermann Theisen, 0177-2168985
Roland Blach (GAAA-Koordinator), 0177-2507286
erstellt von Frila - 10.06.2005
Bush tat alles, um die Atomwaffensperrvertrags-Verhandlungen scheitern zu lassen
Von Robin Cook - Erschienen in The Guardian / ZNet vom 29. Mai 2005
Kein Tag vergeht, ohne dass einer aus Bushs Team uns über die Bedrohung durch Massenvernichtungswaffen belehrt bzw. uns versichert, die Weiterverbreitung (Proliferation) von Kernwaffen zu stoppen, habe absolute Priorität für sie. Seltsam nur, dass die UNO-Konferenz zur Überprüfung des Atomwaffensperrvertrags1 heute Abend ohne greifbares Ergebnis abgebrochen wird - es sei denn, kurz vor 12 geschieht noch ein Wunder. Ebenso seltsam, dass keine der anwesenden Delegationen sich mehr bemühte, ein Abkommen über notwendige Maßnahmen zu verhindern, als gerade die Bush-Delegation.
Die Tragödie: Der Atomwaffensperrvertrag mag zwar Fehler haben, aber er ist der beste Schutz gegen die Weiterverbreitung von Atomwaffen, die die internationale Gemeinschaft derzeit besitzt. Der Vertrag, der von allen Nationen (außer einer handvoll) unterstützt wird, stellt unmissverständlich klar: Es ist tabu, Nuklearwaffen zu entwickeln. Mit diesem Peergruppen-Druck wurde erreicht, dass die Zahl der Länder, die ihre Atomwaffen abschaffen, mittlerweile die der Länder übersteigt, die sich Atomwaffen zulegen.
Südafrika gab nach dem Kollaps des Apartheidregimes seine Atomwaffen auf und zerstörte sie. Die neuen Republiken, die auf dem Territorium der ehemaligen Sowjetunion entstanden (siehe Ukraine), wollten nichts vom Erbe der Atomwaffensysteme auf ihrem Territorium wissen. Argentinien und Brasilien handelten untereinander einen Antiatomvertrag aus und verzichten auf eine Weiterverfolgung ihrer Atomprogramme. Selbst der Irak hatte, wie sich herausstellte, sein Atomwaffenprogramm eingestellt. In diesem speziellen Fall brachte der Erfolg des Atomwaffensperrvertrags Bush allerdings in ziemliche Verlegenheit.
Früher wurden die Überprüfungskonferenzen, die alle fünf Jahre stattfinden, als wichtige Chance genutzt, um neue Unterstützung für den Atomwaffen-sperrvertrag zu werben. Diesmal war es anders. Das diplomatische Washington konzentrierte sich darauf zu verhindern, dass die Versprechungen, die Clinton auf der letzten Überprüfungskonferenz gemacht hatte, irgendwie in die jetzige Agenda einfließen konnten - was letztendlich dazu führte, dass die beiden ersten Konferenzwochen mit Streit über die Agenda draufgingen. Für substantielle Gespräche blieb kaum eine Woche Zeit. Der ehemalige US-Verteidigungsminister Robert McNamara2, gewiss kein Peacenik, bemerkte, wenn die Leute draußen in der Welt davon erführen, “würden sie nicht tolerieren, was auf der NPT-Konferenz3 vor sich geht”.
Der Erfolg des Atomwaffensperrvertrags beruhte in der Vergangenheit auf einem Deal zwischen den Staaten ohne Nuklearwaffen (wir werden keine Ambitionen entwickeln, uns Atomwaffen zuzulegen) und den Nuklearmächten (wir vertrauen darauf und machen uns im Gegenzug ans Abrüsten). Passt zur Administration von George Bush, dass jetzt so getan wird, als ginge es beim Atomwaffen-sperrvertrag lediglich darum, die Weiterverbreitung von Nuklearwaffen zu stoppen. Ursprünglich war es die Intention des Atomwaffensperrvertrags, für eine atomwaffenfreie Welt zu sorgen - was ein viel ambitionierteres Ziel ist. Die heftigen Wortgefechte auf der diesjährigen Überprüfungskonferenz spiegeln die Frustration der großen Mehrheit der Nationen - die keine Atomwaffen entwickelt haben und der Meinung, sind, ihren Teil des Vertrags erfüllt zu haben. Aber die privilegierten Eliten mit Atomwaffen gaben kein Zeichen, dass sie gewillt sind, ihre Waffen preiszugeben.
Im Jahr 2000, auf der letzten Überprüfungskonferenz, trug die britische Delegation unter Peter Hain zur Aushandlung eines 13-Schritte-Abkommens bei - mit dem Ziel, die zunehmende Kluft zwischen beiden Parteien (Nuklearmächte und Nichtnuklearmächte) zu überbrücken. Die Nuklearmächte sollten 13 spezifische Schritte zur Abrüstung unternehmen. Die britische Labour-Regierung zeigte sich den Ansprüchen der Vereinbarung einigermaßen gewachsen. Großbritannien nahm sämtliche der nichtstrategischen Kernwaffen aus dem Programm und rüstete 70% seiner nuklearen Explosivkapazitäten (insgesamt) ab. Großbritannien stoppte die Produktion waffenfähigen Materials und stellte sämtliches spaltbare Material, so weit es sich nicht in nuklearen Gefechtsköpfen befindet, unter internationale Aufsicht. Ein positiver Fortschritt - der praktisch zunichte gemacht wird, falls Tony Blair, wie von ihm angedroht, den Bau eines neuen Atomwaffensystems (als Ersatz für Trident) genehmigt. Bislang sieht die britische Bilanz noch positiv aus.
Nicht, dass sich England im Konferenzraum Gehör verschafft hätte. Schließlich identifiziert es sich fast vollständige mit George Bush und war auf der Überprüfungskonferenz darum bemüht, um Verständnis für dessen Position zu werben. Dessen Position lässt sich leicht auf den Punkt bringen: Die Verpflichtungen aus dem Nichtweiterverbreitungsvertrag sind für andere Nationen bindend, nicht aber für die USA - für die USA gilt das Freiwillig-keitsprinzip. Sogar während die Konferenz noch tagte, forderte das Weiße Haus vom Kongress Forschungsmittel zur Entwicklung einer bunkerknackenden Atombombe (bunker buster). Die Entwicklung neuer Nuklearwaffen - vor allem, wenn es sich nicht um Defensiv- sondern um Kriegswaffen handelt - , ist das genaue Gegenteil dessen, was die USA auf der letzten Überprüfungskonferenz zum Atomwaffensperrvertrag gefordert hatten.
Ihre Begründung für die Bunkerbuster ist verräterisch: Die Waffen sollen dazu dienen, tiefvergrabene Arsenale von Massenvernichtungswaffen zu durchdringen und zu zerstören. Schon pervers, dass das derzeitige Regime in Washington nicht auf die Idee kommt, die von ihm betriebene Entwicklung neuer Nuklearwaffen könnte ein Hindernis auf dem Weg zu einem multilateralen Nonproliferations-Abkommen darstellen. Vielmehr sieht Washington das eigene Vorgehen als geeignete unilaterale Maßnahme an, die Weiterverbreitung von Atomwaffen zu stoppen. Wie immer dieser rambohafte Ansatz der Nonproliferation begründet wird, jedenfalls steht nicht zu erwarten, dass man sich mit dem Rest der Welt über einen Text, der diesen Ansatz legitimiert, einigen wird können.
Sehr wahrscheinlich wird es so lange keinen Fortschritt beim Atomwaffen-sperrvertrag geben, bis George Bush durch einen anderen US-Präsidenten ersetzt ist - ein Präsident, der gewillt ist, zu multilateraler Diplomatie zurückzukehren. Dies ist umso besorgniserregender, als weitere dringliche Probleme anstehen und keinen Aufschub dulden.
Einer der Knackpunkte im Design des Vertrags selbst: Der Atomwaffen-sperrvertrag kam vor Tschernobyl zustande - durch Verhandlungen - in einer Zeit also, als die Zukunft der zivilen Kernenergie noch rosig erschien. Daher kam im Vertrag folgender Deal zustande: Die Nuklearmächte geben ihr Know-how über die friedliche Nutzung der Atomenergie an die nicht atomaren Länder weiter; diese verpflichten sich im Gegenzug, Wissen auf dem Gebiet der Nuklear-technologie nicht militärisch zu nutzen. Schon damals haben viele von uns gewarnt, es ist ein Widerspruch in sich, den Atomwaffensperrvertrag zur Verbreitung der (zivilen) Kernenergie zu nutzen.
Wen kann auf diesem Hintergrund die Irankrise wundern - die sich um die fortschreitenden Nuklearambitionen des Landes dreht. Die Verhandlungsposition des Westens gegenüber dem Iran steht in mehreren Punkten auf wackligen Beinen. Einer dieser Punkte: Der Atomwaffensperrvertrag enthält keine Klausel, die dem Iran ein offenes Nuklearprogramm zur Energiegewinnung verbieten würde. Andererseits scheint es irgendwie unplausibel, dass der Iran auf Kernkraft angewiesen ist, schließlich sitzt das Land auf einem ganzen See von Rohöl.
Als Lösung sollte man einen Zusatz zum Atomwaffensperrvertrag anstreben, der Ländern ohne Nuklearwaffen die atomare Wiederaufbereitung, bei der waffenfähiges Material anfällt, verbietet. So entsteht kein Material zum Bau von Atombomben. Allerdings würde dies die derzeitige asymmetrische Kluft zwischen den Nuklearmächten und allen andern Nationen weiter vertiefen. Wir können demnach nur verhandeln, wenn wir selbst ernsthaft an Abrüstung interessiert sind und dies auch belegen.
Falls die Überprüfungskonferenz in New York tatsächlich ergebnislos abgebrochen wird4, werden heute Abend in Washington die Korken knallen, einige dort werden feiern, dessen bin ich mir sicher. Französischer Champagner wird nicht fließen - zu ausländisch - sondern dessen Imitation aus dem Napa Valley. Sie haben gesiegt - in ihrem eigenen beschränkten Sinne. Ein weiteres multilaterales Abkommen konnte gestoppt werden, ohne dass man selbst in die Schusslinie geriet, weil man die Verpflichtungen aus dem letzten Abkommen nicht eingelöst hat. Längerfristig hat Washington die Nonproliferation aber geschwächt - und die Welt zu einem noch gefährlicheren Ort gemacht. Das nächste Mal, wenn sie uns wieder einen besorgten Vortrag über die Massenvernichtungswaffen halten, sollten wir sie einfach nicht mehr ernstnehmen.
Anmerkungen der Übersetzerin:
1 Näheres in Wikipedia unter Atomwaffensperrvertrag
2 Robert S. McNamara, US-Verteidigungsminister im Vietnamkrieg (unter Kennedy u. Johnson), Weltbankpräsident, der sich später selbstkritisch zum Vietnamkrieg äußerte, setzt sich heute für nukleare Abrüstung ein. Ein lesenswertes aktuelles Interview zum Thema mit dem mittlerweile 88jährigen McNamara erschien kürzlich in der Zeitschrift “Der Freitag”
3 NPT (“Non-Proliferation Treaty” = “Atomwaffensperrvertrrag”)
4 Die Konferenz ist am 26. Mai 2005 gescheitert
Quelle: ZNet Deutschland vom 01.06.2005. Übersetzt von: Andrea Noll. Orginalartikel: America’s Broken Nuclear Promises Endanger Us All
erstellt von Frila - 10.06.2005
Von Michael Schmid
Am 17. Mai 2005 ist unser Lebenshaus-Mitglied Klaus Vack 70 Jahre alt geworden. Zwei Tage zuvor konnte seine Frau Hanne ihren 65. Geburtstag feiern. Ich gratuliere beiden von Herzen und wünsche alles Gute - vor allem Gesundheit, Kraft, Lebensfreude.
Es war wohl ca. 1974 als ich bei meinem Studium an der Pädagogischen Hochschule Esslingen an einem Büchertisch auf Materialien des Sozialistischen Büros gestoßen bin. Klaus Vack war damals Sekretär des Sozialistischen Büros und auch mit schriftlichen Beiträgen in den Materialien sehr präsent.
Als ich Anfang der 80er Jahre gemeinsam mit Uli Jäger in einer Studie die Geschichte der Friedensbewegung der Bundesrepublik aufarbeitete (“Wir werden nicht Ruhe geben…”, erschienen beim Verein für Friedenspädagogik. Tübingen, 1982), stießen wir auch in diesen Zusammenhängen vielfach auf Klaus Vack.
Kein Wunder, denn seit der Remilitarisierung Westdeutschlands Mitte der 50er Jahre hat sich Klaus immer in vorderster Front in der Friedensbewegung engagiert. Er gilt als Initiator und Ideengeber, als Koordinator verschiedener Strömungen in der Friedensbewegung und als unermüdlicher Organisator ebenso an der Basis wie bei den großen zentralen Antikriegskampagnen. Über lange Jahrzehnte war er eine der wichtigsten Persönlichkeiten in den außerparlamentarischen Bewegungen. Dass er es dabei nicht zu so viel Popularität gebracht hat wie so mancher seiner früheren Mitstreiter - etwa Gerhard Schröder oder Joseph Fischer - liegt daran, dass er sich stets einer möglichen Karriere im etablierten Politikbetrieb zugunsten eines basispolitischen Engagements verweigerte. Gemeinsam mit seiner Frau Hanne hat er sein bisheriges Leben fast ausschließlich der Arbeit in außerparlamentarischen Organisationen und Bewegungen gewidmet. Dieses umfassende und zugleich vielfältige Engagement kann hier natürlich nicht vollständig aufgelistet werden.
Klaus Vack war Sekretär des Verbandes der Kriegsdienstverweigerer, Koordinator der Ostermärsche der 60er Jahre, aktiv in der Desertionskampagne für GIs, die nicht nach Vietnam wollten und sich mit couragierter Hilfe nach Skandinavien absetzen konnten.
1980 gehörten Hanne und Klaus Vack zu den Mitbegründern des Komitees für Grundrechte und Demokratie. Sie waren als Sekretärin und Sekretär des Komitees angestellt, die sich dort bis zu ihrem altersbedingten Ausscheiden 1998 aus allen Funktionen als nimmermüde Akteure des Komitees betätigten. In dieser Zeit standen wiederum die friedenspolitischen Aktivitäten im Vordergrund ihres Engagements. So haben sie dann in der “neuen” Friedensbewegung der 80er Jahre gegen die Stationierung von Mittelstreckenraketen (Pershing 2) an den großen Demonstrationen in Bonn und 1983 an der Menschenkette von der US-Kommandozentrale Eucom in Stuttgart bis zum Raketenstationierungsgelände in Neu Ulm und vor allem an hunderten Aktionen des zivilen Ungehorsams in Mutlangen mitgewirkt.
Als Organisations- und Überzeugungstalent hatte Klaus Vack ein enges Netz von Beziehungen auch zu “Prominenten” geknüpft. Und so brachte er zahlreiche prominente Persönlichkeiten dazu, im Sommer 1983 nach Mutlangen zu kommen. Mutlangen war bis dahin ein unbekanntes Dorf am Rande der Schwäbischen Alb, Stationierungsort der Pershing 1A seit langem, vorgesehen als erster Stationierungsort der neuen atomaren Pershing 2. Klaus Vack rief, und es kamen unter anderem Inge Aicher-Scholl, Heinrich Albertz, Heinrich Böll, Günter Grass, Helmut Gollwitzer, Walter Jens, Horst-Eberhard Richter, Erhard Eppler, Oskar Lafontaine, Petra Kelly, Dietmar Schönherr und viele weitere “Promis”. Gemeinsam mit tausenden weiteren Demonstranten wurden vom 1. bis 3. September 1983 die Zufahrtswege zur Raketenstellung blockiert. 25 Fernsehteams und 150 Journalisten aus der ganzen Welt waren anwesend. Nach dieser “Prominentenblockade” war aus Mutlangen ein weit über die Grenzen der Bundesrepublik hinaus bekannter Stationierungsort der atomaren Pershing 2 geworden. Klaus gebührt dafür eine gehörige Portion an Verdienst.
Aber auch das Engagement in ökologischen Bürgerinitiativen oder z.B. in der Volkszählungsboykott-Bewegung gehören zu der politischen Biographie von Hanne und Klaus Vack. Weiter galt ihr politisches und menschenrechtliches Engagement der Hilfe für Gefangene und für die Rechte von Ausländern sowie für unverkürztes politisches Asyl in der Bundesrepublik.
In den letzten Jahren ihrer Tätigkeit im Komitee für Grundrechte und Demokratie war ihr Einsatz für humanitäre, friedenspolitische und menschenrechtliche Hilfe im ehemaligen Jugoslawien in den Mittelpunkt gerückt. Seit Beginn des Krieges im ehemaligen Jugoslawien haben Hanne und Klaus Vack, unterstützt durch Freundinnen und Freunde sowie weitere Mitglieder des Komitees für Grundrechte und Demokratie, bis 1998 auf insgesamt 97 Reisen in umkämpfte und zerstörte Gebiete für ca. 13,9 Millionen DM humanitäre und friedenspolitische Hilfe geleistet. Diese gewaltige Summe wurde ausschließlich von privaten Spenderinnen und Spendern gesammelt. Die Hilfe ging anfangs unter dem Titel “Helfen statt Schießen” überwiegend an Flüchtlinge in den verschiedensten Lagern in allen jugoslawischen Nachfolgerepubliken. Kriegs- und Flüchtlingskinder wurden bei diesen Hilfsaktionen besonders bedacht. Es entwickelte sich eine enge Zusammenarbeit mit vielen Friedensgruppen in verschiedenen Teilen Ex-Jugoslawiens. Angesichts der erbärmlichen Lebensumstände bildete aber die humanitäre Unterstützung den Schwerpunkt bei fast allen Reisen. Begleitend zu den Hilfslieferungen wurden dann 1994 erstmals Ferienfreizeiten für Waisen- und Flüchtlingskinder durchgeführt. Seit Beginn der Aktion hat das Komitee in den vergangenen elf Jahren über 17.000 Kinder und Jugendliche jeweils für zwei Wochen zu “Ferien vom Krieg” einladen können. Diese Aktion wird bis heute fortgeführt, auch wenn Hanne und Klaus in den vergangenen Jahren nicht mehr selber mit dabei waren.
Angesichts dieses unglaublichen Engagements hat der Theologe Helmut Gollwitzer zum 50. Geburtstag von Klaus Vack geschrieben: “Wir müssten Dich multiplizieren können. Da das nicht in unserer Macht steht, können wir nur hoffen, dass Dein Beispiel andere dazu erweckt, ihre Fähigkeiten so zu entwickeln und in den Dienst einer Politik der Humanität zu stellen.”
Nun ist Klaus Vack 70 geworden und kann aus altersbedingten und gesundheitlichen Gründen nicht mehr so weitermachen wie noch vor 20 oder 10 Jahren. Nehmen wir uns ein Beispiel an Klaus Vack.
Für mich persönlich war das undogmatische Verständnis von Sozialismus, das emanzipatorische Politikverständnis, aber vor allem die engagierte Praxis äußerst wichtig und hat nachhaltigen Einfluss auf meinen eigenen Lebensweg ausgeübt - ermutigend, stärkend, hoffnungmachend. Dafür herzlichen Dank!!!
Deshalb, das möchte ich zum Schluss nicht verhehlen, erfüllt es mich mit Freude und macht mich auch ein bisschen stolz (das darf in diesem Zusammenhang ja wohl sein!), dass Klaus Vack Mitglied unseres kleinen Vereins Lebenshaus Schwäbische Alb ist! Begründet hat er dies einmal wie folgt: “Mir gefällt die Perspektive des Lebenshauses: ‘Investieren in Gerechtigkeit und Frieden.’ Doch wichtiger: Trotz gegenläufiger und zerstörerischer gesellschaftlicher Entwick-lungen wird im Lebenhaus praktisch gegen den herrschenden Strom geschwommen. Im Sinne von Ernst Blochs ‘Prinzip Hoffnung’. Als Rentner möchte ich solche Initiativen wie das Lebenshaus wo immer es geht durch direkte Mitarbeit und, wenn die km-Entfernungen zu groß sind, zumindest finanziell unterstützen. Human gesehen brauchen wir solche Anfänge, Nischen der Menschlichkeit, überall - auch auf der Schwäbischen Alb.”
Abschließend möchte ich noch ein Motto von Klaus Vack zitieren, von dem ich mich gerne anstecken lasse: “Weitermachen für den Frieden. Fange nie an aufzuhören. Höre nie auf anzufangen.”
Quelle:
Webseite des Lebenshaus Schwäbische Alb
erstellt von Frila - 10.06.2005
Frauen an der Waffe - die Unterwanderung einer Männerkultur? Ein international angelegter Sammelband unterzieht frauenfeindliche Vorurteile und pazifistisch-feministische Hoffnungen einer Revision
VON ULRIKE BAUREITHEL
Während wir von den nachge"spielten" Misshandlungen in der Bundeswehr hören, haben wir gleichzeitig noch die verstörenden Bilder aus Abu Ghraib in Erinnerung: die 21-jährige Reservistin Lynndie England, die irakische Gefangene sexuell demütigt. Hätte an ihrer Stelle ein Mann vor der Kamera posiert, der Skandal wäre nur halb so groß gewesen. Doch eine Frau, die für "weibliche Friedfertigkeit" steht und - als Soldatin - für die friedensstiftende Seite des Krieges, im Mittelpunkt eines derart unwürdigen Gewaltexzesses? Das erschüttert nicht nur die gepflegten Wahrnehmungsmuster, sondern setzt auf eine ganz neue Weise das Thema Frauen und Militär auf die Tagesordnung. Mit dem Eintritt von Frauen in die militärische Männerdomäne war schließlich auch einmal die Hoffnung verbunden, diese zu demokratisieren.
Frauen in Uniform und mit der Waffe in der Hand sind keine Aus-nahmeerscheinung mehr. Selbst in der Bundesrepublik haben wir uns, wenn auch mit einiger Verzögerung und erst durch das Urteil des Europäischen Gerichtshofes im Jahre 2000 angestoßen an Soldatinnen gewöhnt. Die lange Debatte in den siebziger und achtziger Jahren - die Frage, ob Frauen überhaupt Waffendienst tun sollen - ist ausdiskutiert bzw. von der Wirklichkeit überholt: Die friedensbewegt-feministischen bzw. frauenfeindlichen Argumente und Bedenken sind stumpf geworden angesichts einer jüngeren Frauengeneration, die die Streitkräfte als selbstverständliches Berufsfeld betrachtet und gleiche Karrierechancen fordert. Nun haben zwei Fachfrauen, Ruth Seifert und Christine Eifert, diese von Frauen "unterwanderte" Männerkultur einer vorläufigen Inspektion unterzogen: Wie integrieren sich Frauen in die Armee, und welche Auswirkungen hat ihre Präsenz auf die militärische Kultur? Wie ist der Umgang zwischen Soldaten und Soldatinnen, gibt es tatsächlich gleiche Aufstiegsmöglichkeiten und wie nehmen die Streitkräfte bzw. die Öffentlichkeit Frauen an der Waffe wahr?
Schwächung männlicher Kampfkraft
Was die Herausgeberinnen in ihrem Sammelband Gender und Militär präsentieren, zeitigt Erwartbares, aber auch Überraschendes. Wenig erstaunlich ist beispielsweise, dass der Nachweis eines "weiblichen Arbeitsvermögens" im Hinblick auf militärische Dienste bislang noch immer aussteht und die Integrationsgegner bzw. Karrierebremser deshalb zunehmend mit der "Schwächung männlicher Kampfkraft" argumentieren, um zu verhindern, dass Frauen an Kampfhandlungen beteiligt werden bzw. in die Kommandozentralen aufsteigen. Folgerichtig bemühen sich die meisten Länder weiterhin, Frauen, obwohl diese gleichberechtigt in die Armee aufgenommen werden, von der Kampfzone fern zu halten. Ein sowohl definitorisch als auch praktisch problematisches Unterfangen, weil "kampf-ferne" Verwendungen unvermittelt umschlagen können und gerade die "Etappe" - man denke an die Versorgungseinheiten im Irakkrieg - zum umkämpften Truppenteil werden kann.
Sensationell ist auch nicht der fast durchweg konstatierte Befund, dass es Frauen im Militär mit dem Aufstieg in die höheren Ränge noch viel schwerer haben als im zivilen Leben: In den obersten Führungsschichten sind Frauen Exotinnen; selbst in den mittleren Chargen findet man sie vergleichsweise selten. Das ist in Israel, wo als einzigem westlich orientierten Land Frauen dienstpflichtig sind, ebenso wie in Russland oder Japan. Interessant am Fall Israel ist aber, wie Orna Sasson-Levy zeigt, dass die potentielle Möglichkeit für Frauen, sich im Militär als "Staatsbürgerinnen" zu beweisen, keineswegs emanzipatorische Wirkungen hat, eher im Gegenteil. Gerade die rigide Genderpolitik des Militärs reproduziert, so ihr Ergebnis, die in der Gesellschaft gültigen hierarchischen und essentialistischen Wahrnehmungen von Männlichkeit und Weiblichkeit.
Gender in der japanischen Armee
Ganz anders in Japan, wo, wie Sabine Frühstück nachzeichnet, Frauen nur eine von mehreren Genderfiguren in der Jieitai, der japanischen Armee, darstellen. Ein Grund liegt vor allem darin, dass die japanische Armee historisch so kompromittiert ist, dass diese gezwungen ist, nach neuen Orientierungen zu suchen. Die Integration von Frauen und ihre öffentliche Darstellung ist offenbar eine wirkungsvolle Strategie der Jieitai, sich wie jede andere japanische Organisation zu präsentieren. Dass die Rekrutierung von Soldatinnen auch schlichte Notwendigkeit war, nachdem im Wirtschaftswunder immer weniger Männer ihre Zukunft in der Armee suchten, ist dabei keine japanische Besonderheit; auch das nachsowjetische Russland füllt seine Linien mit Frauen auf und verbessert damit das Image der Armee.
Die Interviews, die Christine Eifler mit russischen Soldatinnen geführt hat, gehören (zusammen mit den O-Tönen von israelischen Dienstpflichtigen) zu den Höhepunkten dieses ansonsten zu sehr auf Wahrnehmungen und Bilder orientierten Sammelbandes. Aus der Perspektive der Betroffenen erfährt man vom weiblichen Alltag in einer Armee, von den Gründen, sich als Frau zu verdingen, von ihren Vorstellungen von "Dienst" und "Disziplin" und ihren Auffassungen, wie "Frauen nach Frauenart" und "Männer nach Männerart" zu behandeln seien. Zur Sprache kommt auch der alltägliche Sexismus, der jedoch bagatellisiert wird, denn "Sexobjekt" zu sein verträgt sich nicht mit der Rolle als aktive Soldatin. Die Verdrängung sexistischer Erfahrungen ist nicht nur typisch für russische Soldatinnen, sondern ein länderübergreifendes Phänomen.
Wenn, wie Edna Levy, die zweite Berichterstatterin für Israel, schreibt, die Demokratisierung der Armee ein Indiz für die Demokratisierung der Gesellschaft ist, dann steht es mit letzterer in den etwas willkürlich gewählten, vorgestellten Ländern (USA, Großbritannien, Israel Deutschland, Ungarn, Russland, China, Japan) nicht allzu gut; auch dort nicht, wo das sozialistische Gleichheitspostulat wie in China (das historisch übrigens interessanteste Beispiel) noch offiziell gilt.
Die Koppelung von staatsbürgerlichem Status und Militärdienst ist, wie der theoretisch am weitesten ausgreifende Beitrag von Francine D'Amico vorführt, ohnehin ideologisch, weil aus dem kämpfenden Soldat nicht notwendig ein gleichberechtigter Bürger wird. Ob das Militär allerdings von innen heraus, sozusagen durch den weiblichen Gang durch die Institution, demokratisiert werden kann, wie es in manchen Beiträgen gelegentlich aufscheint, sei dahingestellt. Man muss den Fall Lynndie England nicht unbedingt symptomatisch deuten; doch die von den Autorinnen dokumentierten Tatsachen lassen wenig Spielraum für Illusionen.
Ruth Seifert/Christine Eifler/Heinrich-Böll-Stiftung (Hrsg.): Gender und Militär. Internationale Erfahrungen mit Frauen und Männern in den Streitkräften. Ulrike Helmer Verlag, Königstein/Ts. 2004, 312 Seiten, 24,95.
erstellt von Frila - 10.06.2005
Wahlen, Militäroffensiven und Todesschwadrone –
Herrschaftsstrategien der USA in dem besetzten Land (Teil I)
Von Joachim Guilliard
Ein »dreifaches Hoch auf die Bush-Doktrin« schrieb der Pulitzerpreisträger Charles Krauthammer Anfang März im Time Magazine. Die erfolgreiche Abhaltung der Januar-Wahlen im Irak sei der endgültige Beweis für die Richtigkeit der Entscheidung, in den Irak einzumarschieren. Auch viele Kritiker hätten eingesehen, daß es richtig gewesen sei, militärische Macht zur Durchsetzung demokratischer Ideale einzusetzen und dadurch eine Transformation der arabischen Welt in Gang zu setzen – von endloser Tyrannei und Intoleranz hin zu anständiger Staatsführung und Demokratisierung. Mit den »historisch einmaligen« Wahlen in Afghanistan und Irak, der freien Wahl einer »moderaten« palästinensischen Führung und der »Zedern-Revolution« im Libanon sei die US-Administration mit ihrem »großen Projekt« einer »pan-arabischen Reformation« vorangeschritten, einem »gefährlichen, riskanten und, ja, arroganten aber notwendigen Versuch, die Kultur des Mittleren Osten als solche« zu ändern, um »die Türen zu Demokratie und Moderne zu öffnen.« Die Wahlen im Irak seien möglich geworden, weil die USA nach »dem Schwert«, das das alte Regime stürzte nun den »Schild bereitstellten, der acht Millionen Irakern die erste Ausübung von Selbstregierung« ermöglichte.1
»Geölte« Besatzung
Die Ausführungen des neokonservativen Kolumnisten der Washington Post Krauthammer sind typisch dafür, wie offizielle US-amerikanische Stellen und ihre Verbündeten die im Januar durchgeführten Wahlen zur Rechtfertigung ihrer Politik benutzen.2 Obwohl diese Wahlen ganz offensichtlich demokratischen Standards nicht genügten, wurden sie auch von den Regierungen Deutschlands und anderer eher »kriegskritischer« europäischer Länder anerkannt.
Selbst eine Reihe namhafter Kritiker der US-Politik und erklärter Besat-zungsgegner wie z.B. Noam Chomsky begrüßten – trotz Kritik im Detail – die Wahlen grundsätzlich als Sieg über die Gewalt und als wichtigen Schritt in Richtung Souveränität und Demokratie.
Das ist eine Illusion, wie ein genauerer Blick auf den Charakter der Wahlen und auf den sogenannten »Übergangsprozeß« – d.h. die von den USA konzipierte Reorganisation des irakischen Staates – zeigt. Das Land bleibt weiterhin unter vollständiger Kontrolle der Besatzungsmacht und steht seit der Installation der ersten Interimsregierung ununterbrochen unter Kriegsrecht. Die Wahlen liefern nun den Vorwand, um einen schmutzigen Krieg gegen all die zu intensivieren, die sich den US-Plänen entgegenstellen. Es waren Wahlen, um die »Besatzung zu ölen«, so Salim Lone, ein ehemaliger hoher UN-Mitarbeiter im Irak, nicht, um sie zu beenden.
Der Urnengang zu einem – aus Sicht der USA – so frühen Zeitpunkt war zunächst ein Zugeständnis der Besatzungsmacht an die Besatzungsgegner. Dies ist auch einer der Gründe, weshalb Noam Chomsky die Wahlen positiv wertet. Washington stimmte zu, um zu verhindern, daß angesichts des wachsenden militärischen Widerstandes nicht auch noch die bis dahin passiven Gegner in die offene Rebellion getrieben werden.
Die US-Administration sicherte sich die volle Kontrolle über den gesamten Prozeß. Nicht nur die Wahlen, auch die Grundlagen, auf der die neu gewählten Institutionen arbeiten sollen, wurden von der Besatzungsmacht vorgegeben. In mehr als einhundert Verordnungen, die der einstige Statthalter Paul Bremer vor der Übergabe der formalen Regierungsgewalt an die erste Interimsregierung erlassen hatte, sind die wesentlichen Bereiche in Staat und Wirtschaft bereits fest im Sinne der USA geregelt (siehe hierzu J. Guilliard, »Wahlen als Waffe im Krieg – Ein Überblick über den Wahlprozeß im Irak,
http://www.embargos.de/irak/occupation/hintergrund/wahlen_waffe_jg.htm).
Wochenlanges Postengeschacher
US-Juristen hatten im wesentlichen auch die provisorische Verfassung entworfen. Hier wurde eine Zweidrittelmehrheit für die Wahl der Übergangsregierung und eine Dreiviertelmehrheit für Änderungen an der Verfassung oder Bremers Erlassen festgelegt. Zudem ist stets auch die einstimmige Zustimmung des dreiköpfigen Präsidentenrates nötig. Insgesamt war damit schon sichergestellt, daß das Parlament selbst bei ungünstigem Wahlausgang, den von der Besatzungsmacht vorgegeben Weg nicht verlassen kann.
Das Wahldesign tat sein übriges. Da die Spitzenpositionen aller wichtigen Wahllisten mit Vertretern der verbündeten Organisationen besetzt waren, sitzen nun auch mehrheitlich dieselben Leute in der neuen Regierung, die schon den provisorischen Vorgängerregierungen angehörten. Die meisten von ihnen hatten die Jahrzehnte davor im Ausland verbracht und sind erst mit den Besatzungstruppen in den Irak zurückgekehrt.
Dennoch dauerte der Kampf um Einfluß und Pfründe fast drei Monate, bis sich die Wahlsieger am 28. April endlich auf ein (unvollständiges) neues Kabinett einigen konnten. Neben den Forderungen der kurdischen Parteien nach einem raschen Anschluß der ölreichen Region um Kirkuk an die von ihnen beherrschten Nordprovinzen ging der Streit vor allem um die Kontrolle und die Zusammensetzung der neuen Sicherheitsapparate, die im Laufe des letzten Jahres unter Führung des bisherigen Regierungschefs Iyad Allawi aufgebaut worden waren, unter Einbeziehung einer großen Zahl kollaborationswilliger Angehöriger aus den Sicherheitsdiensten des alten Regimes. Allawi, der engste Verbündete der US-Regierung, forderte für seine Liste daher u. a. das Innenministerium. Die führenden Partien auf der schiitischen Liste, die die Mehrheit der Stimmen erhielt, SCIRI und Dawa, haben allerdings kein Interesse daran, daß sich säkulare, ehemals baathistische Kräfte einen eigenen Machtapparat aufbauen. Sie wollten das Innenressort daher selbst übernehmen und kündigten zunächst auch an, die Ministerien und Sicherheitsdienste von allen zu säubern, die führende Positionen in der Baath-Partei oder im alten Staat innehatten.
Dies zwang die US-Regierung, massiver in die Verhandlungen einzugreifen. US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld flog Anfang April persönlich nach Bagdad und machte klar, daß die irakischen Sicherheitskräfte für die neue Regierung tabu sind. Die einstigen Mitglieder von Saddam Husseins geheimer Polizei seien die »kompetentesten« Kräfte, um den Widerstand zur Strecke zu bringen.
Schließlich einigten sich die US-Verbündeten auf Jalal Talabani, Chef der Patriotischen Union Kurdistans (PUK), als Staatspräsidenten. Seine Stellvertreter wurden Adel Abdel Mahdi vom SCIRI und der bisherige Präsident Ghazi al Yawer, ein reicher und einflußreicher sunnitischer Stammesführer.
Zum neuen Regierungschef wurde Dawa-Chef Ibrahim Jaafari bestimmt, der aus Sicht Washingtons akzeptabelste Kandidat aus der schiitischen UIA-Liste. Jaafari gilt als moderater Schiit und enger Verbündeter der USA. Er steht im Gegensatz zu den SCIRI-Führern auch nicht im Verdacht enger Verbindungen zum Iran. »Er ist unser Junge, nicht der des Iran«, verlautete es aus dem Weißen Haus.
Das neue Kabinett
Das Ausscheiden Allawis ist die einzige Überraschung bei dieser neuen Regierung. Er wird dennoch der wichtigste Mann Washingtons beim Aufbau irakischer Kapazitäten zur Aufstandsbekämpfung bleiben und aufgrund persönlicher Loyalitäten die Kontrolle über die neuen »Sicherheitskräfte« behalten. Für Kontinuität war ohnehin gesorgt. In allen Ministerien bleiben die vom ehemaligen Statthalter Bremer eingesetzten US-amerikanischen »Berater« im Amt und sorgen dafür, daß keines vom rechten Weg abkommt.
Mit dem kurdischen Warlord Jalal Talabani gelangte einer der wendigsten irakischen Politiker an die nominelle Spitze des Staates, mit einer langen Geschichte zwielichtiger Bündnisse mit jedem, der ihm gerade nützlich schien. »Er hat so oft die Seiten gewechselt, daß es sehr ermüdend für mich wäre, jede Wendung aufzuzählen«, charakterisierte ihn Dilip Hiro in einem Interview. In den westlichen Medien wird Talabani gerne als »entschiedener Saddam-Gegner« und als großer Demokrat gefeiert. Auch dieses Bild trügt. Er herrscht als Warlord genauso autokratisch über seinen Teil des Autonomiegebietes wie sein kurdischer Rivale, KDP-Chef Mahssud Barzani. Wie dieser ging er auch mit Saddam Hussein immer wieder Bündnisse ein. Die letzten Bilder, auf denen zu sehen ist, wie Talabani und Hussein einander herzen, stammen vom Juni 1991.3
Die wichtigste Rolle dürfte für Washington aber Talabanis Stellvertreter Adel Abdel Mahdi (SCIRI) zukommen. Der einstige Maoist, der sich zum freien Marktwirtschaftler im radikalislamischen Gewand wandelte, war bisher provisorischer Finanzminister gewesen. Er hatte die von Paul Bremer verordnete Schocktherapie durchgeführt, die die irakische Wirtschaft völlig deregulierte und dem ausländischen Kapital öffnete. Mahdi gilt als der Mann, der die Fortsetzung von Bremers Arbeit garantieren soll.4 Als Vizepräsident kann er im Bedarfsfall jede Änderung an den Verordnungen der Besatzungsbehörde mit seinem Veto blockieren.
Zur Seite wurde ihm Ali Abdel Amir Allawi als Finanzminister gestellt, Chef einer erfolgreichen Londoner Investmentfirma und Berater der Weltbank. Sein Vater war während der Monarchie Gesundheitsminister gewesen. Ali Allawi, der mütterlicherseits ein Neffe Ahmed Chalabis und väterlicherseits ein Cousin von Iyad Allawi ist, hatte den Irak 1956 als Neunjähriger verlassen.
Rückkehr Chalabis
Alarmierend für Iraker ist die Rückkehr des scheinbar unverwüstlichen Ahmed Chalabi. Dem in Jordanien wegen Millionenbetrugs verurteilten Chef des Irakischen Nationalkongresses wurde neben dem Amt des stellvertretenden Ministerpräsidenten zunächst auch kommissarisch das Ölministerium übergeben, bevor es seinem Vertrauten Ibrahim Bahr al-Uloum zugeschlagen wurde. Überall, wo Chalabi und seine Leute mit größeren Geldsummen in Berührung kamen, verschwand ein guter Teil davon auf mysteriöse Weise. Es ist davon auszugehen, daß das gesamte lukrative Ministerium bald von seinen Anhängern durchsetzt sein wird. Obwohl der einstige Pentagonliebling aufgrund seiner zwielichten Machenschaften und mutmaßlichen Verbindungen zum iranischen Geheimdienst in Ungnade gefallen war, wird dennoch vermutet, daß die US-Administration bei der Besetzung des Ölministeriums die Hand im Spiel hatte – Widerstände gegen Privatisierungsmaßnahmen sind von Chalabis Seite nicht zu erwarten.
Auch die Ernennung von Baqir Jabr zum Innenminister verheißt wenig Gutes. Sein eigentlicher Name ist Bayan Sulag – Baqir Jabr ist sein Kriegsname, den er als führendes Mitglied der Badr-Brigaden, dem bewaffneten Arm des SCIRI, erhielt.
Einen Einblick in seine früheren Aktivitäten gibt ein Bericht von Radio Free Europe vom Mai 2000 über einen Raketenangriff auf einen der Regierungspaläste in Bagdad. In einem Interview übernahm Jabr im Namen von SCIRI die Verantwortung für den Anschlag, der mehrere Opfer unter den Angestellten gefordert hatte.
Die Badr-Brigaden wurden im Iran ausgebildet, die meisten der z. T. sehr jungen Milizionäre sind auch dort aufgewachsen und Anhänger der Ideen Ayatollah Khomeinis. Sie führten in den 1990er Jahren eine ganze Reihe von Anschlägen im Irak aus, denen auch eine größere Zahl von Zivilisten zum Opfer fiel. Sie stehen im Verdacht, mit Beginn der Besatzung Todesschwadrone aufgebaut und eine große Zahl ehemaliger Baath-Mitglieder und Funktionäre sowie sonstige politische Gegner ermordet zu haben.
Der SCIRI und die Badr-Brigaden haben sich bisher wie die beiden Kurdenparteien einer Auflösung ihrer Milizen widersetzt. Sie sprechen sich dafür aus, ihre Truppen verstärkt zur Bekämpfung des Widerstands einzusetzen, wodurch der Krieg tatsächlich zunehmend bürgerkriegsähnliche Züge annehmen würde.
PUK und KDP verfügen über je 15 000 Vollzeitkämpfer in quasi regulären Armee-einheiten und weiteren 20 000 bis 25 000 Stammesmilizionäre, insgesamt also über 75 000 Mann.5 Sie stellen damit nach den US-Truppen die mit Abstand größte Streitmacht im Irak. Die Badr-Brigaden werden auf eine Stärke von bis zu 15 000 Mann geschätzt, die ebenfalls gut ausgebildet sind. Auch Dawa und Chalabi sowie weitere US-Verbündete unterhalten eigene Milizen. »Diese Leute bedrohen uns mit einem Warlord-System, daß unser ganzes Land zerstören könnte«, so Wamidh Nadhmi, Sprecher des Irakischen Nationalen Grün-dungskongresses.
Auch die Aufteilung nach ethnisch/konfessionellen Kriterien führt zu heftigen Protesten, auch innerhalb der Nationalversammlung. Hashim Abdul-Rahman al-Shibli, der als »Minister für Menschenrechte« nominiert worden war, um die Zahl der Sunniten im Kabinett zu erhöhen, weigerte sich, auf dieser Basis in die Regierung einzutreten: »die Konzentration auf konfessionelle Identitäten«, führe »zu Spaltungen in Gesellschaft und Staat«.
1 Charles Krauthammer »Three Cheers for the Bush Doctrine –-History has begun to speak, and it says that America made the right decision to invade Iraq«, Time, 7.3.2005.
2 Liberale Kommentatoren stehen ihnen kaum nach. »Bis zu den jüngsten Wahlen im Irak und unter den Palästinensern, war die moderne arabische Welt weitgehend immun gegen die Winde der Demokratie die überall sonst in der Welt geblasen haben« schrieb z.B. auch Thomas L. Friedman in der New York Times v. 7.4.2005 (»Arabs Lift Their Voices«)
3 Dilip Hiro, »Iraq’s New President Jalal Talabani: Ally of CIA, Iranian Intelligence and Saddam Hussein«, Democracy now, 7.4.2005.
4 Pepe Escobar, »What’s behind the new Iraq« und »The shadow Iraqi government« , Asia Times, 8.4.2005 bzw. 21.4.2005
5 Squabble over Iraqi militias, Asia Times, 23.4. 2005.
junge Welt vom 18.5.2005
erstellt von Frila - 25.05.2005
Wahlen, Militäroffensiven und Todesschwadronen im Irak –
Herrschaftsstrategien der USA in dem besetzten Land
(Teil II und Schluß)
Von Joachim Guilliard
* Im gestern erschienenen ersten Teil des Artikels wurde die Einflußnahme der US-Regierung auf den Wahlprozeß im Irak untersucht.
Durch das monatelange Postengeschacher nach den Wahlen im Irak vom 30. Januar bis zu ihrer Vereidigung am 4. Mai 2005 hat auch das Image der neuen Regierung schon stark gelitten. Sich ernsthaft für einen verbindlichen, engen Zeitplan für den Abzug der US-Amerikaner einzusetzen ist ihre einzige Möglichkeit, sich unter den Irakern Glaubwürdigkeit zu verschaffen. Da sie sich aber ohne deren Schutz nicht halten könnte, wird sie dies aus Eigeninteresse und aus Rücksicht auf die tatsächlichen Machtverhältnisse jedoch nicht tun.
Die Beherrscher des Landes sind weiterhin die USA mit ihren 140000 Soldaten und zahlreichen zivilen und militärischen Einrichtungen in der »Green Zone« Bagdads. Jeder, der den Irak bereist, kann sehen, wie sich die Besatzungsmacht auf Dauer im Land festsetzt. Beispielsweise im Camp »Victory North«, in der Nähe des Flughafens von Bagdad. Hier baut die Halliburton-Tochter Kellog, Brown & Root (KBR) seit über einem Jahr an einer ganzen Stadt, bestehend aus klimatisierten Bungalows, Turnhallen, Burger King, einem riesigen Supermarkt und allem, was sonst noch zum US-amerikanischen Way of Life gehört. Die Stadt beherbergt bereits 14000 Soldaten; fertiggestellt wird das Camp doppelt so groß sein wie Camp »Bondsteel« im Kosovo, bis dato eine der größten US-Basen in Übersee.
Insgesamt werden in der Region zur Zeit vierzehn Basen ausgebaut, die zusammen über 100000 Soldaten aufnehmen sollen. Diese permanent anwesenden Einheiten sollen längerfristig auch die militärische Basis der von dem renommierten konservativen US-Journalisten Krauthammer erwähnten »panarabischen Reformation« sein, jenem »Versuch, die Kultur des Mittleren Ostens als solche« zu ändern, d. h. die arabischen und islamischen Länder von Nordafrika bis zum Kaspischen Meer in prowestliche, neoliberale kapitalistische Staaten zu verwandeln.
Noch aber sind alle US-Kräfte im Irak gebunden. Von durchschnittlich mehr als 60 Angriffen täglich berichten die US-Kommandeure vor Ort, Teile des Landes sind seit langem der Kontrolle der US-Armee weitgehend entzogen. Weder mit breitgefächerten Großoffensiven noch mit massiven Angriffen auf mutmaßliche Hochburgen ihrer Gegner konnte die US-Armee den Widerstand schwächen. Er wurde im Gegenteil ständig stärker und militärisch effektiver. Der Aufbau einer US-geführten irakischen Armee bleibt zahlenmäßig weit hinter den Erwartungen zurück. Die Einsatzbereitschaft der neuen Polizei- und Armeeeinheiten ist schwach und deren tatsächliche Loyalität ungewiß. So war die erste Maßnahme der US-Truppen während ihrer Militäroffensive »Operation River Blitz« gegen den Widerstand in den Städten am Euphrat z. B., so der Christian Science Monitor, die Gefangennahme der Polizisten der Stadt.
Der verdeckte Krieg
Nach wie vor sind sich die Besatzer über die Stärke und Organisation ihres Gegners weitgehend im unklaren. Nach Schätzungen von General Muhammed Schahwani, dem von Paul Bremer eingesetzten Chef des neuen irakischen Geheimdienstes, stehen ihnen 40000 »Hardcore-Kämpfer« gegenüber, unter-stützt von 150000 Irakerinnen und Irakern, die als »Teilzeitguerillakämpfer«, Kundschafter und logistisches Personal arbeiteten. Diese können, so Schahwani, auch auf Unterstützung oder Duldung durch große Teile der Bevölkerung zählen. Schahwani war bereits unter Saddam Hussein Geheimdienstchef, bevor er das Land verließ und sich Ijad Allawis National Accord anschloß.
Auch die US-Administration hat erkannt, daß ihre Truppen im Irak einem fest in der Bevölkerung verankerten Widerstand gegenüberstehen. Sie setzt daher zunehmend auf einen verdeckten, »schmutzigen« Krieg. Bereits im Dezember 2003 enthüllte der US-Journalist und Pulitzerpreisträger Seymour Hersh entsprechende Programme der US-Regierung, die Geheimdienstexperten an die »Operation Phönix« in Vietnam erinnern. Das Pentagon bezeichnet einem Artikel der US-Zeitschrift Newsweek zufolge die diesbezüglichen Pläne lieber als die »Salvador Option« – in Anknüpfung an die erfolgreichere Anwendung bzw. des Einsatzes von staatlichem Terror, Folter und Todesschwadronen gegen oppositionelle Kräfte in Mittelamerika.1
Wie Hersh herausgefunden hatte, war schon im Herbst 2003 mit Hilfe von israelischen Experten mit der Ausbildung von Spezialeinheiten zur gezielten Liquidierung von Besatzungsgegnern begonnen worden; sie dürften mittlerweile längst im Einsatz sein.2 Hinzu kommt der massive Einsatz von privaten Söldnern, die keiner Kontrolle unterliegen, darunter viele frühere Geheimdienstoffiziere und ehemalige Angehörige von Sondereinheiten der Armee.
Für Peter Maass von der New York Times steht nach seinen Recherchen vor Ort auch fest, daß die Vorlage für den heutigen Irak nicht Vietnam, sondern El Salvador ist, wo ab 1980 eine rechtsgerichtete Diktatur mit US-Unterstützung eine linksgerichtete Befreiungsbewegung bekämpfte. Über 70000 Menschen wurden in dem zwölfjährigen Krieg getötet, die meisten von ihnen Zivilisten.3 Im Irak entsteht aber eher eine Mischung aus beidem, denn Maas übersieht, daß Irak nach wie vor ein militärisch besetztes Land ist, in dem sich 140000 US-Soldaten im direkten Einsatz gegen eine Widerstandsbewegung befinden, welche sich in erster Linie gegen diese Besatzung wendet.
Der verdeckte Krieg soll im wesentlichen von den verbündeten Irakern selbst geführt werden. Ijad Allawi hat hierfür in seiner Amtszeit als Chef der Übergangsregierung u. a. mit Kriegsrecht und dem Aufbau eines neuen »Sicherheitsapparates« die entscheidende Vorarbeit geleistet. Vieles davon verrät die Handschrift von US-Botschafter John Negroponte, der als Botschafter in Honduras auch in Mittelamerika die Fäden zog und eine Reihe von »Beratern« mit einschlägigen Erfahrungen aus dieser Zeit in die Ministerien entsandt hat.
»Special Police Commandos«
Unmittelbar nach seinem Amtsantritt hatte Allawi mit dem Aufbau einer Geheimpolizei begonnen, die als Speerspitze bei der Aufstandsbekämpfung fungieren soll. Als Sicherheitsberater, der den Aufbau des neuen »allgemeinen Sicherheitsdirektorats« (General Security Directorate, GSD) unterstützen sollte, ernannte er den Generalmajor Adnan Thavit al Samarra’i, ein ehemaliger hoher Geheimdienstoffizier Saddam Husseins, der sich an Allawis gescheitertem Putschversuch 1996 beteiligt hatte.
Scheinbar über Nacht traten bald darauf neue paramilitärische Einheiten in Erscheinung, die ebenfalls mit der »Salvador Option« in Verbindung gebracht werden und stark an die rechten Paramilitärs in Kolumbien erinnern. Mittlerweise agieren mindestens sechs dieser vom US-Militär »Pop-Ups« genannten Milizen, verteilt über den gesamten Irak. Die relativ gut bezahlten Kämpfer kommen überwiegend aus den Sicherheitsdiensten und Sondereinheiten der Armee des alten Regimes und haben den Korpsgeist und die Disziplin, die die USA bei den regulären irakischen Militär- und Polizeikräften so sehr vermissen.
Die stärkste dieser schwerbewaffneten Milizen, die »Special Police Commandos«, besteht aus 5000 bis 10000 Kämpfern. Sie waren u. a. im letzten Oktober am Angriff auf Samarra beteiligt, der als Probelauf für den Sturm auf Falludscha galt. Die »Commandos« agieren z. B. aber auch in Mosul, Ramadi und weiteren Zentren des Widerstands. Ihr Kommandeur ist der oben erwähnte Sicherheitsberater Adnan Thavit, einer der engsten Verbündeten Allawis und Onkel des bisherigen Innenministers Falah Al Naqib. Nach eigenen Angaben handelt es sich bei seinen Leuten um Polizeikräfte, die bereits früher »Erfahrungen im Kampf gegen Terrorismus« sammeln konnten sowie um Leute, die unter dem früheren Regime ein spezielles Training erhalten hatten.
Mindestens zwei weitere dieser Milizen, die Muthana-Brigade und die »Defenders of Khadamiya«, stehen in direkter Verbindung zu Allawi. Sie erhalten mittlerweile alle massive Unterstützung vom Pentagon. Die Gesamtstärke dieser neuen irregulären Brigaden, die von den US-Kommandeuren als neue Avantgarde im Kampf gegen den Aufstand betrachtet werden, wird auf über 15000 Mann geschätzt. Da die Loyalität der Milizionäre aber ihren jeweiligen Führern und nicht der Besatzungsmacht gilt, hat sich das Pentagon hier neue Warlords herangezüchtet.
Der Name »Pop-Ups« ist jedoch irreführend. Die Milizen schossen nicht über Nacht aus dem Boden. Erste Pläne zur Schaffung solcher Einheiten wurden bereits Ende 2003 bei Treffen zwischen CIA und Allawi geschmiedet und gehörten somit zum nichtöffentlichen Teil des damals beschlossenen »Übergangskonzeptes«. Allawi hatte den Aufbau solcher »Polizei-Spezialeinheiten« noch vor seinem Amtsantritt angekündigt.
Einheiten der US Marines unterhalten ihre eigenen Milizen, u. a. die »Iraqi Freedom Guard« und die »Freedom Fighters«. Sie setzen sich vorwiegend aus radikalen Schiiten aus dem Süden zusammen und wurden in Operationen der Marines in der Al-Anbar-Provinz, einem der Zentren der Gegenwehr gegen sunnitische Widerstandskämpfer, eingesetzt.
Todesschwadronen
Aufgrund von Äußerungen General Wayne Downings, des nun in Ruhestand gegangenen früheren Chefs aller Sondereinsatzkräfte der USA, ist davon auszugehen, daß im Rahmen dieser neuen Kommandos auch Todesschwadronen agieren. In einem Fernsehinterview hatte Downing den Einsatz solcher paramilitärischen Einheiten in El Salvador als zulässige und nützliche Taktik bezeichnet und ergänzt, daß die USA nun auch »Special Police Commandos« im Irak hätten, die »diese Art von Angriffsoperationen durchführen«. Eine ganze Reihe bekannter Vorfälle stützen diese Aussage.
Belegt ist jedenfalls, mit welcher Brutalität diese Sonderbrigaden gegen Verdächtige vorgehen. Der bereits erwähnte Peter Maass wurde selbst mehrfach Augenzeuge schwerer Mißhandlungen von Verdächtigen durch Thavits »Commandos«, die stets von einer kleineren US-Einheit begleitet werden, und er hörte Berichte von US-Soldaten über brutale Folter in den Gefängnissen.4
Die US-Armee versucht, die Brutalität als Folge irakischer »Tradition« hinzustellen, die sie abzumildern sucht. Dagegen spricht, daß führende »US-Berater« der Milizen über langjährige einschlägige Erfahrungen aus Mittelamerika verfügen. Unmittelbar am Aufbau und Einsatz der neuen Milizen beteiligt ist z. B. James Steele, der in den 80er Jahren in El Salvador als Chef einer Sondereinheit des US-Militärs die dortigen Todesschwadronen der Regierung »beriet«. Eine ähnliche Karriere hat Steve Casteel, »Berater« im irakischen »Innenministerium«, der sich den größten Teil seines bisherigen Berufslebens im schmutzigen Drogen- und Antiguerillakrieg in Peru, Bolivien und Kolumbien engagierte.
»Indem die Medien die Wahlen als Triumph der Bush-Administration darstellten«, so US-Ökonom und Medienkritiker Edward S. Herman, »und damit, wie in den früheren vietnamesischen und salvadorianischen Wahlen, teilweise als Rechtfertigung für Aggression und Besatzung (aggression-occupation), geben sie der Regierung freiere Hand.« Sie werde »zuerst ihr Programm der Befriedung durch Gewalt intensivieren, um den Aufstand zu marginalisieren und den Boden für die Herrschaft der Gruppen zu bereiten, die den Invasoren/Besatzern zutiefst verpflichtet sind«, so Herman weiter. Wie Seymour Hersh in »We’ve Been Taken Over By a Cult«5 aufgezeigt habe, »hat die Regierung ihre Bombenangriffe Monat für Monat stetig eskaliert und so den ganzen Irak in eine ›Feuer-frei-Zone‹ verwandelt – ... ›Triff alles, töte jeden‹ – nahezu unberichtet in den Medien, und wir können sicherlich noch mehr dieser Art erwarten.«6
1 »›The Salvador Option‹ – The Pentagon may put Special-Forces-led assas-sination or kidnapping teams in Iraq«, Newsweek, 8.1.2005
2 siehe J. Guilliard, »Irak: Wirtschaftlicher Ausverkauf und neokoloniale Dikta-tur«, Marxistische Blätter 1/2004
3 Peter Maass, »The Way of the Commandos«, New York Times, 1.5.2005
4 Peter Maass, a.a.O.
5 Seymour Hersh, »We’ve Been Taken Over By a Cult«, CounterPunch, 27.1. 2005
6 Edward S. Herman, »The Election In Iraq: The US Propaganda System Is Still Working In High Gear«, Znet, 13.2.2005
* weiterführende Literatur:
- J. Guilliard »Im Treibsand Iraks«, IMI-Studie 2004/03
- Phyllis Bennis, »Reading the Elections«, Institute for Policy Studies, 2. 2.2005.
junge Welt vom 19.5.2005
erstellt von Frila - 25.05.2005

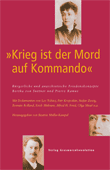
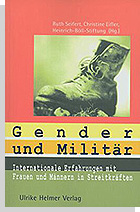


![[EFC Blue Ribbon - Free Speech Online]](http://www.efc.ca/images/efcfreet.gif)