[K]Eine Lizenz zum Töten
KSK-Killerkommandos jagen Drogenbarone in Afghanistan
In den letzten Wochen und Monate entwickelte sich eine rege Reisetätigkeit zwischen Deutschland und Afghanistan. Mehr als 100 KSK-Soldaten brachen im Mai Richtung Hindukush auf, demnächst folgen achthundert Soldaten zur Verstärkung des ISAF-Kontingents und zusätzlich reisen in diesen Tagen einige dutzend Beamte von Zollfahndung und BKA nach Kabul um afghanische Polizisten(1) im Antidrogenkampf zu schulen. Die Nervosität und Konzeptlosigkeit hinter diesem Aktionismus ist kaum zu verheimlichen. Zu gerne hätte die deutsche Regierung ein Erfolgsmodell für militärische Interventionen, das sich positiv gegenüber dem US-Debakel im Irak abhebt. Sowohl für die Wahlen in Deutschland wäre dies hilfreich als auch für den erhofften Aufstieg auf der weltpolitischen Bühne mit Hilfe eines Sitzes im UN-Sicherheitsrat. Doch die schöne Fassade des zivil-militärischen Experiments bröckelt. Der Widerstand in Afghanistan nimmt zu, die Kampfhandlungen der westlichen Truppen ebenso, der Drogenhandel floriert wie nie und das KSK erfüllt völkerrechtswidrige Tötungsaufträge. Von einer Normalisierung scheint die Lage in Afghanistan noch Jahrzehnte entfernt und unter den dort eingesetzten Soldaten macht sich Frustration - und Angst - breit.
Brüchiger Erfolg
In offiziellen Verlautbarungen der Enduring Freeedom Allianz überwiegen die Erfolgsgeschichten. Am 30. Juni 2005 vermeldete das Verteidigungsministerium in Kabul das Ende der Entwaffnung der afghanischen Milizen (dpa 30.6.2005). Im September wird in Afghanistan gewählt und die Sicherheitslage ist angeblich so entspannt, dass Kriegsflüchtlinge seit einigen Wochen laut Beschluss der Innen-ministerkonferenz abgeschoben werden dürfen. Die Hamburger Behörden sind dabei besonders eifrig und wollen nun neben allein stehenden Männern auch verheiratete Paare abschieben. Dass gleichzeitig der Hamburger LKA-Dienststellenleiter Helmut Hedrich gegenüber dem Hamburger Abendblatt (21.7.2005) vor dem Abflug zu seinem Einsatz in Kabul erklärte "Wir werden dauerhaft Schutzwesten tragen, nachts nicht auf die Straßen gehen. Schließlich ist Kabul das Zentrum einer echten Krisenregion," das erscheint den deutschen Behörden nicht als Widerspruch.
Zu einer realistischen Lagebeurteilung ist scheinbar keiner der westlichen Alliierten in der Lage. Noch im Winter erklärte die US-Armee die Taliban für fast völlig aufgerieben "doch seit dem Frühjahr lieferten sich die islamistischen Kämpfer heftige Gefechte mit afghanischen Soldaten und den sie unterstützenden multinationalen Truppen unter US-Kommando, an der auch Bundeswehrsoldaten beteiligt sind." (spiegel-online 1.7.2005) Dieser Widerstand gilt nach der Entwaffnung der "regulären" Milizen nun ausschließlich als kriminell oder terroristisch. In den so genannten illegalen Milizen sind nach Schätzungen (UNAMA) ca. 120.000 Bewaffnete in rund 1.800 Gruppen organisiert.
Narkostaat Afghanistan?
Besonders die Milizen, die als Privatarmee für Drogenbarone fungieren sind allem Anschein nach hervorragend ausgebildet und ausgerüstet. "Schwer bewaffnete Konvois, bis zu 60 Jeeps voller Opium, Heroin und Morphinbase, rasen über die Ebenen im Westen Richtung Iran," berichtet der Stern (7.7.2005) und zitiert einen KSK-Mann mit der Aussage "wir wissen dass ehemalige Kräfte des austra-lischen und des britischen Special Airservice dabei sind." Militärisch sind die Drogenkartelle kaum in den Griff zu bekommen. Schon seit Jahren versuchen die iranischen Behörden - vergeblich - mit über 40.000 Soldaten und Polizisten sowie mit Milliardeninvestitionen in Grenzsicherung (Mauern, Gräbern, Überwachung) den Drogentransit aus Afghanistan zu stoppen.(2)
In Afghanistan wird 50% des Bruttoinlandsprodukts über Drogenanbau und -handel erzielt. Die Rhetorik der westlichen Staaten blendet aus, dass sehr viele Menschen in Afghanistan existenziell auf diese Einnahmen angewiesen sind und wie stark deswegen der Widerstand sein wird, wenn westliche Truppen - oder von diesen eingesetzte afghanische Sicherheitskräfte - die Mohnfelder vernichten. Im Distrikt Rustak etwa kam es im Mai zu schweren Unruhen, nachdem zahlreiche Mohnfelder niedergebrannt worden waren. In der Weltbankstudie "Breaking the conflict trap" (2003) wird die begrenzte Umsetzbarkeit eines rein sicherheits-politischen Ansatzes, der nur auf Verbot und Zerstörung der Produktion ausgerichtet ist, erläutert und darauf verwiesen, dass durch bloße Verbotspolitik Bürgerkriege geradezu herbeigeführt werden. "Das Problem dieses produktions-orientierten Ansatzes ist, dass es Gebiete außerhalb der Kontrolle einer anerkannten Regierung enorm wertvoll werden lässt und so automatisch dazu beiträgt Rebellionen zu fördern." (S.144) Erfolgversprechender erscheint es hier, die Kooperation der Bauern durch ökonomische Alternativen zum Mohnanbau zu unterstützen und durch eine aufgeklärte Drogenpolitik in den Abnehmerstaaten (z.B. kontrollierte Abgabe von Heroin an Abhängige) die Gewinnspanne und damit die Attraktivität des Handels zu senken. Überhaupt scheinen sich in Afghanistan viele Fehler aus früheren Phasen der Entwicklungspolitik zu wiederholen. Anstatt z.B. den Bauern Mindestpreise für ihre Weizenernte zu garantieren, wird der Preis durch Hilfslieferungen gedrückt.
Letztes Aufgebot
Doch ursachenorientierte und langfristige Drogenpolitik steht nicht auf der Tagesordnung der alliierten Besatzer in Afghanistan. Die Devise scheint zu lauten, wo Gewalt nicht hilft, da ist eben noch mehr Gewalt notwendig. Geplant ist, dass der alte Bundestag noch vor seiner Auflösung, wahrscheinlich am 7. September 2005, über die Erhöhung des ISAF-Kontingents auf 3000 Soldaten abstimmen soll. Zur Zeit stocken auch zahlreiche andere Staaten ihre Militärkontingente in Afghanistan auf. Großbritannien, die Niederlande, Australien und Spanien schicken jeweils hunderte von Soldaten - meist Spezialtruppen. Teilweise werden damit die ISAF-Kontingente aufgestockt, die Mehrheit wird jedoch für den so genannten "Antiterroreinsatz" Enduring Freedom entsandt. Die offiziellen Begründungen sind meist Sicherung der Parlamentswahlen im September. Parallel, aber durchaus mit einander verknüpft, werden der ISAF-Einsatz und Enduring Freedom vorangetrieben. Der ISAF-Einsatz soll besonders mit Hilfe der Bundeswehrsoldaten schrittweise auf das ganze Land ausgedehnt werden. Verteidigungsminister Struck erklärte hierzu, es mache wenig Sinn, dass sich die Bundeswehr in Afghanistan räumlich so stark eingrenze(3). In Kunduz wird die Bundeswehr in den nächsten Monaten auch von 93 österreichischen Soldaten, überwiegend Elitesoldaten, so genannte Kaderpräsenzeinheiten unterstützt (Der Kurier 29.7.2005). In Faisabad wird das dortige Bundeswehrkontingent in "Sicherheitsfragen" von den Elitetruppen des Kommandospezialkräfte unterstützt. Die meisten Elitesoldaten der verschiedenen nationalen Kontingente befinden sich aber im formal getrennten "Antiterroreinsatz" Enduring Freedom, der zur Zeit schwerpunktmäßig die Rebellen in der Grenzregion zu Pakistan und die Drogenökonomie angreift. Im Rahmen dieser Auseinandersetzung kamen seit Anfang 2005 mehr als 600 Menschen ums Leben, darunter Aufständische, aber auch zahlreiche Zivilisten und rund 50 US-Soldaten. (vienna-online, 27.7.2005). Die häufigen Opfer in der Zivilbevölkerung tragen sehr zur Verschlechterung der Stimmung gegenüber den Besatzern bei. Anfang Juli starben bei einem US-Luftangriff, vorgeblich auf terroristische Ziele, in der Provinz Kunar im Osten Afghanistans 17 Dorfbewohner, überwiegend Frauen und Kinder. Aber nicht nur die Stimmung gegen das US-Militär ist schlecht, auch die deutschen ISAF-Soldaten sind in der Bevölkerung keineswegs beliebt. Immer wieder gibt es gegen die deutschen Soldaten Anschlagsversuche und Drohungen. Reuters berichtet am 11.7.2005 von einem Angriff auf einen Konvoi mit Bundeswehrsoldaten nahe Kabul.
Beim deutschen Stützpunkt in Kunduz sollen Flugblätter mit der Forderung nach dem Abzug der ausländischen Truppen verteilt worden sein. (Welt 28.6.2005) Schon im Jahr 2003 zitiert die Welt (16.10.) einen Bundeswehrsoldaten mit der Äußerung "Eigentlich wollen uns die Menschen nicht." Der Artikel konstatierte weiter "Zuerst seien die Kinder nur freundlich gewesen, in letzter Zeit hätten jedoch die Steinwürfe zugenommen..." Im Internet sollen Erklärungen afghani-scher Islamisten kursieren, in denen Bundeswehrsoldaten der Tötung von Muslimen beschuldigt werden (Welt 15.7.2005). Die Anwesenheit der westlichen Truppen scheint auch negativ auf die Arbeit von Hilfsorganisationen auszu-wirken. Dass "Helfer als Handlanger" wahrgenommen werden, lässt sich wohl aus den zunehmenden Anschlägen gegen Hilfsorganisationen schließen. Dies liegt möglicherweise daran, dass einerseits Hilfsorganisationen - mehr oder weniger freiwillig - immer stärker mit Militärs kooperieren und andererseits die Besatzungstruppen selbst die Trennung zwischen zivil und militärisch verwischen indem sie versuchen sich als Entwicklungshelfer zu präsentieren (Wiederaufbau-teams!). Jürgen Lieser, Leiter der Katastrophenhilfe von Caritas International, formuliert in einem Positionspapier, das was viele Hilfsorganisationen beschäftigt: "Hilfsorganisationen müssen sich angesichts dieser Entwicklungen fragen, ob sie nicht für politische Zwecke instrumentalisiert werden ..." Enge Kooperation mit dem Militär stellt zudem "die Unabhängigkeit der Hilfsorganisationen in Frage und führt auch zu einer konkreten Gefährdung der Helfer, weil diese von der Gegenseite mit den feindlichen Truppen identifiziert werden."(4)
Drug Enforcement mit Killerkommandos
Zivil-militärische Zusammenarbeit auf einer anderen Ebene stellt die Ausbil-dungshilfe deutscher Polizisten für afghanische Sicherheitskräfte dar. Der Polizeieinsatz ist der einzige bundesdeutsche Einsatz der auch erklärtermaßen ein Antidrogeneinsatz ist. Otto Schily informierte am 22.7.2005 die Öffentlichkeit: "Die Bekämpfung des Drogenanbaus und -handels ist eine der wichtigsten Aufgaben Afghanistans. Wir unterstützen Afghanistan in diesem Kampf und werden es durch professionelle Schulung seiner Sicherheitsbehörden in die Lage versetzen, selbst effektiv gegen den Rauschgifthandel vorzugehen." All zu sehr scheint sich die deutsche Regierung aber nicht auf die Fähigkeit oder Willigkeit der afghanischen Behörden zu verlassen, es deutet alles darauf hin, dass KSK-Soldaten und andere Spezialtruppen seit Mai 2005 massiv Drogenbekämpfung durchführen. Gegenüber dem Stern (7.7.2005) berichteten Soldaten davon, dass "der Einsatz in Afghanistan aufs Ausschalten von Hochwertzielen im Drogen-geschäft hinaus(läuft). Einige Offiziere haben uns nach Stabsbriefings klipp und klar gesagt, dass es um drug enforcement geht." Dass hier nicht an rechtsstaatliche Prozesse gedacht ist ergänzen die Soldaten ganz offen "Wir sollen die Drahtzieher ausschalten, eliminieren." Seit Mai 2005 ist bekannt(5), dass KSK-Kommandos bei ihrem Einsatz im Südosten Afghanistans in begrenztem Umfang über direkte Kampfhandlungen "direct action" selbst entscheiden können. Um was es sich dabei konkret handelt ist erschreckend: "Nie habe man in Calw so hart ‚Direct Action' trainiert wie in diesem Jahr, ‚und zwar die dreckigen Varianten: Mehrere Trupps landen verdeckt, überfallen mit großer Feuerkraft den Feind - kurz gucken, eliminieren.'" Bundeswehrsoldaten üben Attentate, neudeutsch "Assasinationen" - und führen diese wahrscheinlich auch durch. Als "Kommando Spezialkiller" bezeichnet deswegen der Oberstleutnant der Bundeswehr Jürgen Rose das KSK in einem Artikel (Freitag, 22.7.2005). Die Tötungspraxis auf puren Verdacht, in der Regel wohl auf Denunziation und Gerüchte hin widerspricht nicht nur dem Grundgesetz sondern auch internationalem Recht. Die Genfer Konvention (Artikel 3) regelt klar: "Personen, die nicht direkt an den Feindseligkeiten teilnehmen, ... sollen unter allen Umständen mit Menschlichkeit behandelt werden ... Zu diesem Zwecke sind und bleiben in bezug auf die oben erwähnten Personen jederzeit und jedenorts verboten: a.) Angriffe auf Leib und Leben, namentlich Mord jeglicher Art, ... d.) Verurteilungen und Hinrichtungen ohne vorhergehendes Urteil eines ordnungsmäßig bestellten Gerichtes, das die von den zivilisierten Völkern als unerlässlich anerkannten Rechtsgarantien bietet." Dieser Schutz vor willkürlichen Hinrichtungen gilt übrigens völlig unabhängig davon, ob es sich um mutmaßliche Drogenkriminelle oder um mutmaßliche Terroristen handelt. Da allerdings der Kampf gegen Drogenkriminalität nicht vom Mandat des Bundestags gedeckt ist, scheint sich die Praxis einzuspielen, Drogenhandel mit Terrorismus zu identifizieren. Der Bundestagsbeschluss am 17.11.2001 begrenzt die Aufgabe auf Terrorbekämpfung "Ziel ist es, Führungs- und Ausbildungs-einrichtungen von Terroristen auszuschalten, Terroristen zu bekämpfen, gefangen zu nehmen und vor Gericht zu stellen..."(6) Der verteidigungspolitische der SPD, Rainer Arnold, erklärte auf die Frage, ob KSK-Soldaten entgegen ihres Mandats auch gegen Drogenbosse im Einsatz seien: "Da gibt es Überschneidungen. Ein Terrorist kann sein Terrorgeschäft über Drogen finanzieren."(ddp 14.7.2005) Zynisch könnte man vermuten, dass erschossene Drogendealer hinterher immer auch Terroristen gewesen sein werden.
Demokratische Kontrolle ausgeschlossen
Der Öffentlichkeiten und wohl auch vielen Parlamentariern bleibt im Moment kaum mehr als Vermutungen und Indizien über das was das KSK tatsächlich tut. Auf welcher Grundlage die Bundestagsabgeordneten ihre Entscheidung über eine Ausweitung des Bundeswehrmandats treffen sollen bleibt völlig unklar. Alle wichtigen Angaben zu den KSK-Einsätzen sind Verschlusssache - obwohl genau diese Einsätze wesentlich zur Eskalation vor Ort und damit auch zur Gefährdung der Soldaten beitragen. Es gibt keine Informationen über den Umfang, über das Einsatzgebiet, über den genauen Auftrag - noch nicht einmal über die gefallenen Soldaten. Und offensichtlich gab es tote KSK-Soldaten, das Internetportal German-Foreign-Policy spricht von bis zu 12 Toten. Eine Aussage, die der ehemalige Brigadegeneral Heinz Loquai indirekt bestätigt. Ihm sei schon vor einiger Zeit zu Ohren gekommen, "dass deutsche Soldaten bei KSK-Einsätzen ums Leben gekommen sind und die Familienangehörigen massiv unter Druck gesetzt werden, um zu verhindern, dass die Medien darüber etwas erfahren."(7) Nach Angaben von Spiegel-Online (21.5.2005) sind nicht einmal die Obleute der Bundestagsfraktionen über den genauen Auftrag und den militärischen Befehl unterrichtet. Dennoch ist von den meisten Parlamentariern kein Widerstand gegen diese Praxis zu erwarten. Kritische Stimmen kommen allerdings verstärkt von Seiten der Bundeswehrsoldaten und selbst der KSK-Soldaten vor Ort, die sich "als Spielball der Politik sehen"(8) und befürchten für einen Sitz im Weltsicher-heitsrat von der Bundesregierung verheizt zu werden.
Auch wenn die deutschen Todesschwadronen als logische Konsequenz der immer aggressiveren Außen- und Militärpolitik erscheinen: Kriegsverbrechen dürfen niemals toleriert werden! Bundeswehrsoldaten in Afghanistan sind keine Lösung - sie sind Teil des Problems.
Anmerkungen:
(1) Meldung des Bundesministeriums des Innern, 21.7.2005.
(2) Gouverneur, Cédric, Der Opiumkrieg an der Grenze des Iran, in: Le Monde diplomatique, Nr. 6701 vom 15.3.2002.
(3) Sipotec, 21.7.2005.
(4) Lieser, Jürgen: Helfer als Handlanger? Humanitäre Hilfe in den Zeiten der neuen Kriege. http://www.ageh.de/informationen/con_05/con_1_05/Lieser-Caritas-mue.pdf
(5) Haydt, Claudia / Pflüger, Tobias: Eskalation in Afghanistan, 27.5.2005. http://www.imi-online.de/2005.php3?id=1174
(6) siehe: http://www.auswaertiges-amt.de/www/de/aussenpolitik/
friedenspolitik/abr_und_r/jab2002/1/1_2_html#1
(7) Zitiert nach Rose, Jürgen: Kommandos Spezialkiller, Freitag 22.7.2005.
(8) Rauss, Uli: Diesmal wird es Tote geben (Stern 7.7.2005)
Claudia Haydt
IMI-Analyse 2005/020
Informationsstelle Militarisierung
In den letzten Wochen und Monate entwickelte sich eine rege Reisetätigkeit zwischen Deutschland und Afghanistan. Mehr als 100 KSK-Soldaten brachen im Mai Richtung Hindukush auf, demnächst folgen achthundert Soldaten zur Verstärkung des ISAF-Kontingents und zusätzlich reisen in diesen Tagen einige dutzend Beamte von Zollfahndung und BKA nach Kabul um afghanische Polizisten(1) im Antidrogenkampf zu schulen. Die Nervosität und Konzeptlosigkeit hinter diesem Aktionismus ist kaum zu verheimlichen. Zu gerne hätte die deutsche Regierung ein Erfolgsmodell für militärische Interventionen, das sich positiv gegenüber dem US-Debakel im Irak abhebt. Sowohl für die Wahlen in Deutschland wäre dies hilfreich als auch für den erhofften Aufstieg auf der weltpolitischen Bühne mit Hilfe eines Sitzes im UN-Sicherheitsrat. Doch die schöne Fassade des zivil-militärischen Experiments bröckelt. Der Widerstand in Afghanistan nimmt zu, die Kampfhandlungen der westlichen Truppen ebenso, der Drogenhandel floriert wie nie und das KSK erfüllt völkerrechtswidrige Tötungsaufträge. Von einer Normalisierung scheint die Lage in Afghanistan noch Jahrzehnte entfernt und unter den dort eingesetzten Soldaten macht sich Frustration - und Angst - breit.
Brüchiger Erfolg
In offiziellen Verlautbarungen der Enduring Freeedom Allianz überwiegen die Erfolgsgeschichten. Am 30. Juni 2005 vermeldete das Verteidigungsministerium in Kabul das Ende der Entwaffnung der afghanischen Milizen (dpa 30.6.2005). Im September wird in Afghanistan gewählt und die Sicherheitslage ist angeblich so entspannt, dass Kriegsflüchtlinge seit einigen Wochen laut Beschluss der Innen-ministerkonferenz abgeschoben werden dürfen. Die Hamburger Behörden sind dabei besonders eifrig und wollen nun neben allein stehenden Männern auch verheiratete Paare abschieben. Dass gleichzeitig der Hamburger LKA-Dienststellenleiter Helmut Hedrich gegenüber dem Hamburger Abendblatt (21.7.2005) vor dem Abflug zu seinem Einsatz in Kabul erklärte "Wir werden dauerhaft Schutzwesten tragen, nachts nicht auf die Straßen gehen. Schließlich ist Kabul das Zentrum einer echten Krisenregion," das erscheint den deutschen Behörden nicht als Widerspruch.
Zu einer realistischen Lagebeurteilung ist scheinbar keiner der westlichen Alliierten in der Lage. Noch im Winter erklärte die US-Armee die Taliban für fast völlig aufgerieben "doch seit dem Frühjahr lieferten sich die islamistischen Kämpfer heftige Gefechte mit afghanischen Soldaten und den sie unterstützenden multinationalen Truppen unter US-Kommando, an der auch Bundeswehrsoldaten beteiligt sind." (spiegel-online 1.7.2005) Dieser Widerstand gilt nach der Entwaffnung der "regulären" Milizen nun ausschließlich als kriminell oder terroristisch. In den so genannten illegalen Milizen sind nach Schätzungen (UNAMA) ca. 120.000 Bewaffnete in rund 1.800 Gruppen organisiert.
Narkostaat Afghanistan?
Besonders die Milizen, die als Privatarmee für Drogenbarone fungieren sind allem Anschein nach hervorragend ausgebildet und ausgerüstet. "Schwer bewaffnete Konvois, bis zu 60 Jeeps voller Opium, Heroin und Morphinbase, rasen über die Ebenen im Westen Richtung Iran," berichtet der Stern (7.7.2005) und zitiert einen KSK-Mann mit der Aussage "wir wissen dass ehemalige Kräfte des austra-lischen und des britischen Special Airservice dabei sind." Militärisch sind die Drogenkartelle kaum in den Griff zu bekommen. Schon seit Jahren versuchen die iranischen Behörden - vergeblich - mit über 40.000 Soldaten und Polizisten sowie mit Milliardeninvestitionen in Grenzsicherung (Mauern, Gräbern, Überwachung) den Drogentransit aus Afghanistan zu stoppen.(2)
In Afghanistan wird 50% des Bruttoinlandsprodukts über Drogenanbau und -handel erzielt. Die Rhetorik der westlichen Staaten blendet aus, dass sehr viele Menschen in Afghanistan existenziell auf diese Einnahmen angewiesen sind und wie stark deswegen der Widerstand sein wird, wenn westliche Truppen - oder von diesen eingesetzte afghanische Sicherheitskräfte - die Mohnfelder vernichten. Im Distrikt Rustak etwa kam es im Mai zu schweren Unruhen, nachdem zahlreiche Mohnfelder niedergebrannt worden waren. In der Weltbankstudie "Breaking the conflict trap" (2003) wird die begrenzte Umsetzbarkeit eines rein sicherheits-politischen Ansatzes, der nur auf Verbot und Zerstörung der Produktion ausgerichtet ist, erläutert und darauf verwiesen, dass durch bloße Verbotspolitik Bürgerkriege geradezu herbeigeführt werden. "Das Problem dieses produktions-orientierten Ansatzes ist, dass es Gebiete außerhalb der Kontrolle einer anerkannten Regierung enorm wertvoll werden lässt und so automatisch dazu beiträgt Rebellionen zu fördern." (S.144) Erfolgversprechender erscheint es hier, die Kooperation der Bauern durch ökonomische Alternativen zum Mohnanbau zu unterstützen und durch eine aufgeklärte Drogenpolitik in den Abnehmerstaaten (z.B. kontrollierte Abgabe von Heroin an Abhängige) die Gewinnspanne und damit die Attraktivität des Handels zu senken. Überhaupt scheinen sich in Afghanistan viele Fehler aus früheren Phasen der Entwicklungspolitik zu wiederholen. Anstatt z.B. den Bauern Mindestpreise für ihre Weizenernte zu garantieren, wird der Preis durch Hilfslieferungen gedrückt.
Letztes Aufgebot
Doch ursachenorientierte und langfristige Drogenpolitik steht nicht auf der Tagesordnung der alliierten Besatzer in Afghanistan. Die Devise scheint zu lauten, wo Gewalt nicht hilft, da ist eben noch mehr Gewalt notwendig. Geplant ist, dass der alte Bundestag noch vor seiner Auflösung, wahrscheinlich am 7. September 2005, über die Erhöhung des ISAF-Kontingents auf 3000 Soldaten abstimmen soll. Zur Zeit stocken auch zahlreiche andere Staaten ihre Militärkontingente in Afghanistan auf. Großbritannien, die Niederlande, Australien und Spanien schicken jeweils hunderte von Soldaten - meist Spezialtruppen. Teilweise werden damit die ISAF-Kontingente aufgestockt, die Mehrheit wird jedoch für den so genannten "Antiterroreinsatz" Enduring Freedom entsandt. Die offiziellen Begründungen sind meist Sicherung der Parlamentswahlen im September. Parallel, aber durchaus mit einander verknüpft, werden der ISAF-Einsatz und Enduring Freedom vorangetrieben. Der ISAF-Einsatz soll besonders mit Hilfe der Bundeswehrsoldaten schrittweise auf das ganze Land ausgedehnt werden. Verteidigungsminister Struck erklärte hierzu, es mache wenig Sinn, dass sich die Bundeswehr in Afghanistan räumlich so stark eingrenze(3). In Kunduz wird die Bundeswehr in den nächsten Monaten auch von 93 österreichischen Soldaten, überwiegend Elitesoldaten, so genannte Kaderpräsenzeinheiten unterstützt (Der Kurier 29.7.2005). In Faisabad wird das dortige Bundeswehrkontingent in "Sicherheitsfragen" von den Elitetruppen des Kommandospezialkräfte unterstützt. Die meisten Elitesoldaten der verschiedenen nationalen Kontingente befinden sich aber im formal getrennten "Antiterroreinsatz" Enduring Freedom, der zur Zeit schwerpunktmäßig die Rebellen in der Grenzregion zu Pakistan und die Drogenökonomie angreift. Im Rahmen dieser Auseinandersetzung kamen seit Anfang 2005 mehr als 600 Menschen ums Leben, darunter Aufständische, aber auch zahlreiche Zivilisten und rund 50 US-Soldaten. (vienna-online, 27.7.2005). Die häufigen Opfer in der Zivilbevölkerung tragen sehr zur Verschlechterung der Stimmung gegenüber den Besatzern bei. Anfang Juli starben bei einem US-Luftangriff, vorgeblich auf terroristische Ziele, in der Provinz Kunar im Osten Afghanistans 17 Dorfbewohner, überwiegend Frauen und Kinder. Aber nicht nur die Stimmung gegen das US-Militär ist schlecht, auch die deutschen ISAF-Soldaten sind in der Bevölkerung keineswegs beliebt. Immer wieder gibt es gegen die deutschen Soldaten Anschlagsversuche und Drohungen. Reuters berichtet am 11.7.2005 von einem Angriff auf einen Konvoi mit Bundeswehrsoldaten nahe Kabul.
Beim deutschen Stützpunkt in Kunduz sollen Flugblätter mit der Forderung nach dem Abzug der ausländischen Truppen verteilt worden sein. (Welt 28.6.2005) Schon im Jahr 2003 zitiert die Welt (16.10.) einen Bundeswehrsoldaten mit der Äußerung "Eigentlich wollen uns die Menschen nicht." Der Artikel konstatierte weiter "Zuerst seien die Kinder nur freundlich gewesen, in letzter Zeit hätten jedoch die Steinwürfe zugenommen..." Im Internet sollen Erklärungen afghani-scher Islamisten kursieren, in denen Bundeswehrsoldaten der Tötung von Muslimen beschuldigt werden (Welt 15.7.2005). Die Anwesenheit der westlichen Truppen scheint auch negativ auf die Arbeit von Hilfsorganisationen auszu-wirken. Dass "Helfer als Handlanger" wahrgenommen werden, lässt sich wohl aus den zunehmenden Anschlägen gegen Hilfsorganisationen schließen. Dies liegt möglicherweise daran, dass einerseits Hilfsorganisationen - mehr oder weniger freiwillig - immer stärker mit Militärs kooperieren und andererseits die Besatzungstruppen selbst die Trennung zwischen zivil und militärisch verwischen indem sie versuchen sich als Entwicklungshelfer zu präsentieren (Wiederaufbau-teams!). Jürgen Lieser, Leiter der Katastrophenhilfe von Caritas International, formuliert in einem Positionspapier, das was viele Hilfsorganisationen beschäftigt: "Hilfsorganisationen müssen sich angesichts dieser Entwicklungen fragen, ob sie nicht für politische Zwecke instrumentalisiert werden ..." Enge Kooperation mit dem Militär stellt zudem "die Unabhängigkeit der Hilfsorganisationen in Frage und führt auch zu einer konkreten Gefährdung der Helfer, weil diese von der Gegenseite mit den feindlichen Truppen identifiziert werden."(4)
Drug Enforcement mit Killerkommandos
Zivil-militärische Zusammenarbeit auf einer anderen Ebene stellt die Ausbil-dungshilfe deutscher Polizisten für afghanische Sicherheitskräfte dar. Der Polizeieinsatz ist der einzige bundesdeutsche Einsatz der auch erklärtermaßen ein Antidrogeneinsatz ist. Otto Schily informierte am 22.7.2005 die Öffentlichkeit: "Die Bekämpfung des Drogenanbaus und -handels ist eine der wichtigsten Aufgaben Afghanistans. Wir unterstützen Afghanistan in diesem Kampf und werden es durch professionelle Schulung seiner Sicherheitsbehörden in die Lage versetzen, selbst effektiv gegen den Rauschgifthandel vorzugehen." All zu sehr scheint sich die deutsche Regierung aber nicht auf die Fähigkeit oder Willigkeit der afghanischen Behörden zu verlassen, es deutet alles darauf hin, dass KSK-Soldaten und andere Spezialtruppen seit Mai 2005 massiv Drogenbekämpfung durchführen. Gegenüber dem Stern (7.7.2005) berichteten Soldaten davon, dass "der Einsatz in Afghanistan aufs Ausschalten von Hochwertzielen im Drogen-geschäft hinaus(läuft). Einige Offiziere haben uns nach Stabsbriefings klipp und klar gesagt, dass es um drug enforcement geht." Dass hier nicht an rechtsstaatliche Prozesse gedacht ist ergänzen die Soldaten ganz offen "Wir sollen die Drahtzieher ausschalten, eliminieren." Seit Mai 2005 ist bekannt(5), dass KSK-Kommandos bei ihrem Einsatz im Südosten Afghanistans in begrenztem Umfang über direkte Kampfhandlungen "direct action" selbst entscheiden können. Um was es sich dabei konkret handelt ist erschreckend: "Nie habe man in Calw so hart ‚Direct Action' trainiert wie in diesem Jahr, ‚und zwar die dreckigen Varianten: Mehrere Trupps landen verdeckt, überfallen mit großer Feuerkraft den Feind - kurz gucken, eliminieren.'" Bundeswehrsoldaten üben Attentate, neudeutsch "Assasinationen" - und führen diese wahrscheinlich auch durch. Als "Kommando Spezialkiller" bezeichnet deswegen der Oberstleutnant der Bundeswehr Jürgen Rose das KSK in einem Artikel (Freitag, 22.7.2005). Die Tötungspraxis auf puren Verdacht, in der Regel wohl auf Denunziation und Gerüchte hin widerspricht nicht nur dem Grundgesetz sondern auch internationalem Recht. Die Genfer Konvention (Artikel 3) regelt klar: "Personen, die nicht direkt an den Feindseligkeiten teilnehmen, ... sollen unter allen Umständen mit Menschlichkeit behandelt werden ... Zu diesem Zwecke sind und bleiben in bezug auf die oben erwähnten Personen jederzeit und jedenorts verboten: a.) Angriffe auf Leib und Leben, namentlich Mord jeglicher Art, ... d.) Verurteilungen und Hinrichtungen ohne vorhergehendes Urteil eines ordnungsmäßig bestellten Gerichtes, das die von den zivilisierten Völkern als unerlässlich anerkannten Rechtsgarantien bietet." Dieser Schutz vor willkürlichen Hinrichtungen gilt übrigens völlig unabhängig davon, ob es sich um mutmaßliche Drogenkriminelle oder um mutmaßliche Terroristen handelt. Da allerdings der Kampf gegen Drogenkriminalität nicht vom Mandat des Bundestags gedeckt ist, scheint sich die Praxis einzuspielen, Drogenhandel mit Terrorismus zu identifizieren. Der Bundestagsbeschluss am 17.11.2001 begrenzt die Aufgabe auf Terrorbekämpfung "Ziel ist es, Führungs- und Ausbildungs-einrichtungen von Terroristen auszuschalten, Terroristen zu bekämpfen, gefangen zu nehmen und vor Gericht zu stellen..."(6) Der verteidigungspolitische der SPD, Rainer Arnold, erklärte auf die Frage, ob KSK-Soldaten entgegen ihres Mandats auch gegen Drogenbosse im Einsatz seien: "Da gibt es Überschneidungen. Ein Terrorist kann sein Terrorgeschäft über Drogen finanzieren."(ddp 14.7.2005) Zynisch könnte man vermuten, dass erschossene Drogendealer hinterher immer auch Terroristen gewesen sein werden.
Demokratische Kontrolle ausgeschlossen
Der Öffentlichkeiten und wohl auch vielen Parlamentariern bleibt im Moment kaum mehr als Vermutungen und Indizien über das was das KSK tatsächlich tut. Auf welcher Grundlage die Bundestagsabgeordneten ihre Entscheidung über eine Ausweitung des Bundeswehrmandats treffen sollen bleibt völlig unklar. Alle wichtigen Angaben zu den KSK-Einsätzen sind Verschlusssache - obwohl genau diese Einsätze wesentlich zur Eskalation vor Ort und damit auch zur Gefährdung der Soldaten beitragen. Es gibt keine Informationen über den Umfang, über das Einsatzgebiet, über den genauen Auftrag - noch nicht einmal über die gefallenen Soldaten. Und offensichtlich gab es tote KSK-Soldaten, das Internetportal German-Foreign-Policy spricht von bis zu 12 Toten. Eine Aussage, die der ehemalige Brigadegeneral Heinz Loquai indirekt bestätigt. Ihm sei schon vor einiger Zeit zu Ohren gekommen, "dass deutsche Soldaten bei KSK-Einsätzen ums Leben gekommen sind und die Familienangehörigen massiv unter Druck gesetzt werden, um zu verhindern, dass die Medien darüber etwas erfahren."(7) Nach Angaben von Spiegel-Online (21.5.2005) sind nicht einmal die Obleute der Bundestagsfraktionen über den genauen Auftrag und den militärischen Befehl unterrichtet. Dennoch ist von den meisten Parlamentariern kein Widerstand gegen diese Praxis zu erwarten. Kritische Stimmen kommen allerdings verstärkt von Seiten der Bundeswehrsoldaten und selbst der KSK-Soldaten vor Ort, die sich "als Spielball der Politik sehen"(8) und befürchten für einen Sitz im Weltsicher-heitsrat von der Bundesregierung verheizt zu werden.
Auch wenn die deutschen Todesschwadronen als logische Konsequenz der immer aggressiveren Außen- und Militärpolitik erscheinen: Kriegsverbrechen dürfen niemals toleriert werden! Bundeswehrsoldaten in Afghanistan sind keine Lösung - sie sind Teil des Problems.
Anmerkungen:
(1) Meldung des Bundesministeriums des Innern, 21.7.2005.
(2) Gouverneur, Cédric, Der Opiumkrieg an der Grenze des Iran, in: Le Monde diplomatique, Nr. 6701 vom 15.3.2002.
(3) Sipotec, 21.7.2005.
(4) Lieser, Jürgen: Helfer als Handlanger? Humanitäre Hilfe in den Zeiten der neuen Kriege. http://www.ageh.de/informationen/con_05/con_1_05/Lieser-Caritas-mue.pdf
(5) Haydt, Claudia / Pflüger, Tobias: Eskalation in Afghanistan, 27.5.2005. http://www.imi-online.de/2005.php3?id=1174
(6) siehe: http://www.auswaertiges-amt.de/www/de/aussenpolitik/
friedenspolitik/abr_und_r/jab2002/1/1_2_html#1
(7) Zitiert nach Rose, Jürgen: Kommandos Spezialkiller, Freitag 22.7.2005.
(8) Rauss, Uli: Diesmal wird es Tote geben (Stern 7.7.2005)
Claudia Haydt
IMI-Analyse 2005/020
Informationsstelle Militarisierung
erstellt von Frila - 12.08.2005


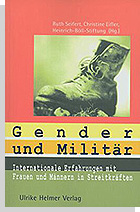


![[EFC Blue Ribbon - Free Speech Online]](http://www.efc.ca/images/efcfreet.gif)